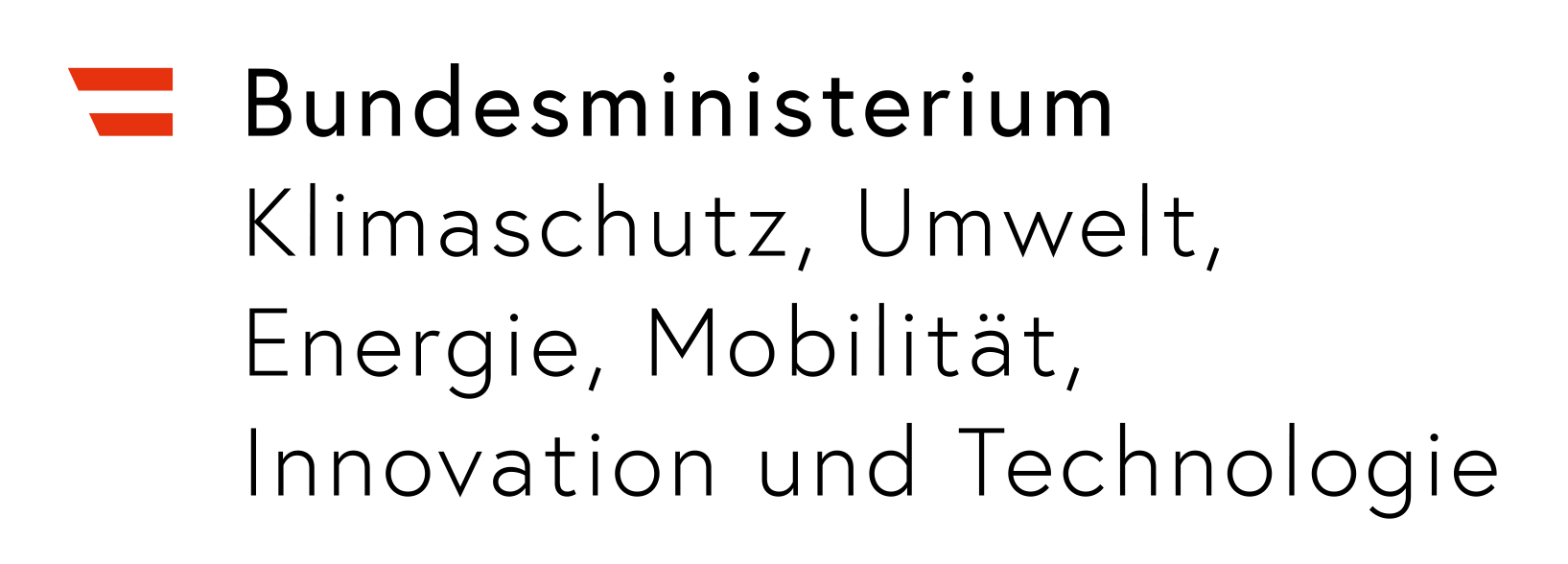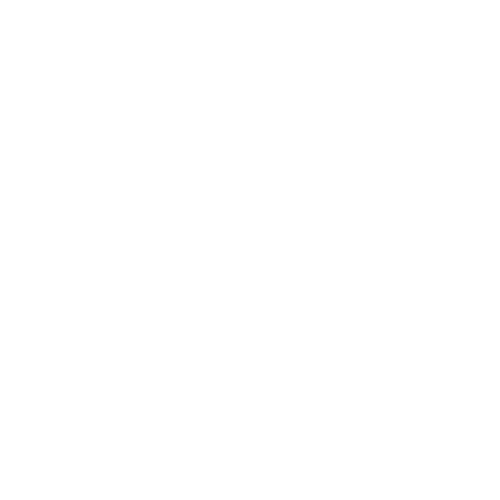Kategorie Innovation & Technologie - 26. Mai 2017
Auch die Stahlschmelze soll grüner werden
Linz – Jules Verne faszinierte der Wasserstoff. Denn dieser könne den Energiebedarf der Menschheit auf lange Zeit sichern. Der Grund: Wasserstoff ist ein Bestandteil des Wassers. Dieses lässt sich mittels Elektrolyse in seine Bestandteile aufspalten: Wasserstoff hier, Sauerstoff dort. Und hat man das farb- und geruchlose Gas erst einmal gewonnen, so kann es in den Produktionsprozessen wieder umgesetzt werden. Das Endergebnis: Wasser. Schadstoffe, die dabei frei werden: null.
Ob dieses umweltfreundlichen Kreislaufes kommen Visionäre heute leicht ins Schwärmen. Denn Wasserstoff ist nicht nur ein geniales Speichermedium für überschüssigen Strom aus Wasser-, Solar- oder Windkraftanlagen, sondern auch vielseitig einsetzbar für neue Wasserstoffautos oder auch für Industrieprozesse wie die Stahlproduktion.
Wer es schafft, eine neue Produktionsweise zu entwickeln, die Kohlenstoff für die Stahlherstellung größtenteils überflüssig machen könnte, würde mit einem Schlag Millionen Tonnen Kohlendioxid an Abgasen einsparen. Ökowasserstoff könnte mittels Elektrolyse aus Ökostrom gewonnen werden, der mittels Windrädern produziert wird. Und dieser Wasserstoff könnte dann Eisenerz zu Stahl umwandeln. In Österreich könnte man so mit einem Schlag rund zwölf Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen.
Frage der Wirtschaftlichkeit
Die ersten Schritte in diese Richtung sind schon gesetzt. Am metallurgischen Kompetenzzentrum K1-MET arbeitet man gerade an einer Pilotanlage, bei der Stahl mit Wasserstoff erschmolzen werden kann. „Das ist Grundlagenforschung“, betont Thomas Bürgler, technischer Geschäftsführer des Zentrums. „Ob Großanlagen jemals machbar sind und wirtschaftlich rentabel wären, kann man heute noch gar nicht sagen.“ Am K1-MET, vom Verkehrs- und vom Wirtschaftsministerium sowie von der Förderagentur FFG unterstützt, sollen jedenfalls Forschungen der Montanuniversität Leoben weitergeführt werden. Dort hat man schon in den letzten drei Jahrzehnten Stahl mit Wasserstoff erschmolzen. „Das war zwar nur in der Größenordnung von einer Teetasse“, meint Johannes Schenk, Professor für Eisen- und Stahlmetallurgie in Leoben. „Im Prinzip aber funktionierte es.“
Deswegen geht man nun am Forschungszentrum K1-MET nach, ob man den Produktionsmaßstab vergrößern kann. Schenk, der hier wissenschaftlicher Geschäftsführer ist, blickt optimistisch in die Zukunft: „2018 werden wir Stahl nicht mehr in Teetassenmengen, sondern bereits Chargen mit ein paar Liter Flüssigstahl erzeugen können.“
Anlage in Donawitz
Eine Technikumsanlage ist in Donawitz auf dem Industriegelände der Voestalpine geplant, wo man über die nötige Infrastruktur verfügt. Der österreichische Stahlproduzent ist neben der Montanuniversität Leoben Konsortialpartner bei diesem Forschungsprojekt.
Doch die Liter-Größe ist erst ein Zwischenschritt. Bis 2030 wollen Bürgler und Schenk die Anlage so weiterentwickeln, dass man mit ihr bereits eine Tonne Stahl pro Stunde erzeugen kann. Genau bei diesen Versuchen wird sich dann zeigen, ob und wie Basis-Equipment entwickelt werden kann, das Wasserstoffmetallurgie im industriellen Großmaßstab ermöglichen kann. Denn für die Produktion von hundert Tonnen Stahl pro Stunde müssen die Anlagen wirklich robust laufen. Nicht nur ein paar Stunden am Tag, sondern rund um die Uhr, Tag und Nacht, wenn möglich 8600 Stunden im Jahr.
Hat man dieses Problem erst einmal gelöst, muss man sich der nächsten Herausforderung widmen. Denn für eine 24/7-Stahlproduktion brauchte man Ökowasserstoff in rauen Mengen. Johannes Schenk hat diese bereits einmal überschlagsmäßig berechnet. Wollte man die gesamte derzeitige Stahlproduktion in Österreich mit Wasserstoff auf Windstrom erschmelzen, wären dafür mindestens 6000 neue Windräder vonnöten. Weil diese aber nur bei Wind Strom liefern, müsste Wasserstoff zwischengespeichert werden oder Ökostrom über weite Strecken transportiert werden. Wo aber so viel Windstrom produzieren? Welche neuen Quellen an alternativer Energie nutzen?
Bis alle diese Fragen gelöst seien, könne man freilich nicht warten, meinen die Forscher. Ein Henne-Ei-Problem. Ohne Investitionen in die Infrastruktur für Ökowasserstoff keine (Öko-)Wasserstoffmetallurgie. Aber wer investierte in die Wasserstoffinfrastruktur, wenn unklar wäre, ob Wasserstoffmetallurgie überhaupt im Großmaßstab funktioniert?
Methode mit Nachteilen
Auf Ebene der Grundlagenforschung sucht man bereits eine Beantwortung dieser Frage. Parallel zum Projekt „Wasserstoff-Metallurgie“ läuft auch das EU-Projekt „H2Future“, an dem K1-MET beteiligt ist. Damit soll grüner Wasserstoff mit Protonen-Austausch-Membran-(PEM-)Technologie produziert werden. Bis man weiß, wie man mit Ökowasserstoff die (Pilot-)Anlage betreiben kann, behilft man sich mit Wasserstoff, der nach der derzeitigen Standardmethode mittels Erdgas-Reforming hergestellt wird. Sein erheblicher Nachteil: Bei seiner Produktion fallen pro Kubikmeter noch immer 0,6 bis 0,8 Kilogramm Kohlendioxid an.
Noch steht es in den Sternen, ob und wann „Ökowasserstoffstahl“ Realität werden wird. Bis 2060/70 wäre ja noch relativ viel Zeit. Denn bis dahin soll nach aktuellen Klimaabkommen der Kohlendioxid-Ausstoß unserer Gesellschaft insgesamt eine technische Null betragen. (Norbert Regitnig-Tillian, 26.5.2017)