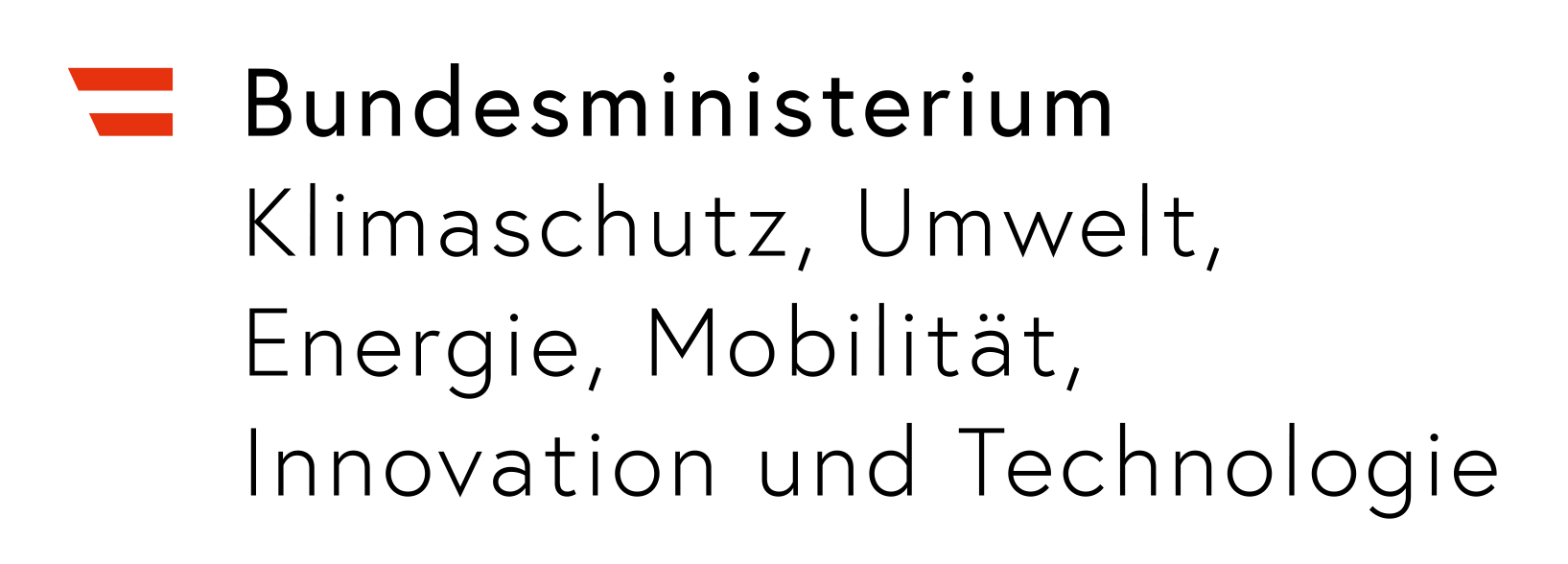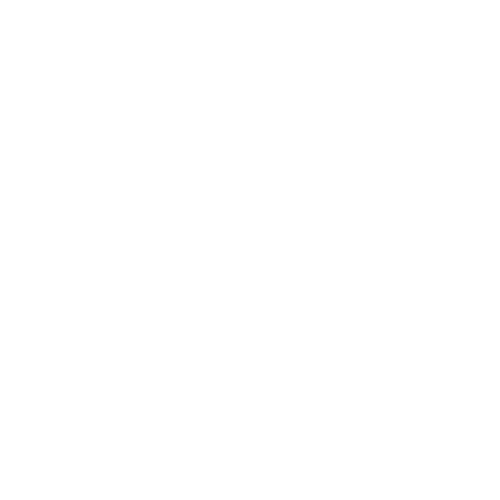29. Juli 2022
Langzeitmonitoring untersucht Klimawandel im Hochgebirge
„Für die wilde Natur sehe ich keine Gefahr – der Mensch ist der Verwundbare!“ Wenn der Botaniker Christian Körner über den Klimawandel spricht, geraten vorgefertigte Vorstellungen von dessen Auswirkungen schnell ins Wanken. Im Rahmen eines Langzeitmonitorings untersucht er mit seinem Team die Folgen der Erderwärmung unter anderem im Tiroler Innergschlöß im Nationalpark Hohe Tauern. Sein Fazit: „Der Trick des Lebens oberhalb der Baumgrenze ist das Mikroklima!“

Was er damit meint, zeigt der emeritierte Professor der Universität Basel oberhalb der Baumgrenze mit Blick auf den Schlatenkees-Gletscher. An Stellen, wo sich Schnee in Mulden sammelt und somit länger liegen bleibt als in der Umgebung, findet man aufgrund der unterschiedlichen Dauer der schneefreien Zeit auf kleinstem Raum verschiedenste Mikrohabitate. „Hier gibt es über nur wenige Meter eine massive Änderung der Lebensbedingungen und damit der Vegetation“, sagte Körner. „Entlang dieses Gradienten ’spielt‘ die Natur bereits heute Klimawandel durch.“
Sensible grasartige Gewächse
Konkret bedeutet das, dass hier über einen mehrjährigen Beobachtungszeitraum entlang eines definierten Rasters beobachtet werden kann, wie sich Pflanzen und Tiere bei Erwärmung verhalten. „Hier haben wir den Übergang vom Günstigen zum Ungünstigen im Raum, den wir normalerweise in der Zeit erwarten“, so Körner. Wird es einer Pflanzenart in ihrem angestammten Habitat zu warm, wandert sie ein Feld weiter nach oben.
„Diese Mikrohabitate verschieben sich parallel zur Klimaerwärmung“, sagt der Forscher. „Wir nützen diese kleinräumige Variation als Modell und beobachten, welche Arten wie reagieren.“ So habe man etwa bereits herausgefunden, dass grasartige Gewächse auf Erwärmung sensibler reagieren als krautige. „Das war für mich augenöffnend“, erzählt Körner.
Dass es nach oben hin irgendwann keinen Platz mehr geben wird, schließt Körner – zumindest für die Alpen – aus. Denn Arten können nicht nur nach oben, sondern im Relief auch zur Seite wandern um ein kühleres Plätzchen zu finden, also zum Beispiel von der Südseite einer Rippe auf deren Nordseite. Lediglich die Größe der Populationen werde sich verändern: „Die Flächen für Arten die es gern kühl haben werden kleiner werden, aber ich bin mir fast sicher, dass wir kühle Habitate und ihre Arten nicht verlieren werden.“
„Revital Integrative Naturraumplanung“
Ein Monitoring in größerem räumlichen Umfang findet im selben Gebiet im Rahmen eines großen Kartierungsprojekts der „Revital Integrative Naturraumplanung“ statt. Dafür waren in den vergangenen zwei Jahren sechs Expertinnen und Experten im Gelände unterwegs, um Lebensräume im Nationalpark zu kartieren. Dies ist über eine eigens entwickelte App erfolgt, in die direkt vor Ort verschiedenste Attribute eingegeben werden. So wurde etwa eine Gesamtartenliste erstellt und pflanzensoziologisch zugeordnet.
Besonders interessant für ein Monitoring sind Flächen, die sich zuletzt stark verändert haben – etwa dort, wo sich der Gletscher gerade erst zurückgezogen hat. „Dort startet die Besiedelung von null weg, dort ist quasi Tabula rasa“, erklärt die Vegetationsökologin Evelyn Brunner von der Revital Integrative Naturraumplanung. „Hier können wir die Sukzession, also die zeitliche Abfolge bis zum Klimax-Stadium, das dann stabil ist, feststellen.“ Als Referenz können Bereiche untersucht werden, wo sich vor 160 Jahren noch Gletscher befunden haben. „Man hat die Zustände ja nebeneinander, man muss nicht 1000 Jahre warten“, freut sich Körner.
„Wir haben 36.000 Punkte mit unterschiedlichen Pflanzen in der Datenbank“, so Brunners Revital-Kollege Andreas Nemmert. „Wir wissen, wie die Pflanzen verteilt sind und können in fünf oder zehn Jahren wieder hingehen und schauen, ob sie noch so vorhanden sind.“ Es lohnt sich also, die Ergebnisse des Projekts im Blick zu behalten.
Klima-Glossar: Gletscherschmelze
Durch die Klimakrise ziehen sich die Gletscher weltweit und immer schneller zurück. In den vergangenen Jahren schwand das Eis bis zu drei Mal rascher als noch im 20. Jahrhundert. Die rund 5.000 Gletscher in den Alpen verloren in nur 15 Jahren ein Sechstel ihres Eisvolumens. Berechnungen zufolge dürfte sich ihre Anzahl in den nächsten Jahren halbieren. Forscher prophezeien: Das Schmelzen lässt sich nicht mehr aufhalten. Das hat dramatische Konsequenzen.
Seit mehr als 120 Jahren sammelt der World Glacier Monitoring Service (Welt-Gletscher-Überwachungsdienst, kurz: WGMS) Daten über die Veränderung der Gletscher weltweit. Die Experten beobachten Referenzgletscher – Gletscher die stellvertretend für die vielen Gletscher stehen sollen – in rund zwanzig Bergregionen der Welt. Darunter sind auch 13 österreichische Gletscher.
Die Pasterze ist der größte Gletscher Österreichs. Die Aufnahmen stammen aus dem Jahren 1920 und 2012 (links: Alpenverein/Laternbildsammlung, rechts: Alpenverein / N. Freudenthaler).
Die Pasterze ist mit rund acht Kilometern der längste Gletscher der Ostalpen und der größte in Österreich. Sie befindet sich am Fuße des Großglockners im Nationalpark Hohe Tauern. Nach Angaben der österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) verlor der Gletscher zwischen 1969 und 2012 über die gesamte Fläche 37 Meter an Eisdicke. Inzwischen geht der Pasterzengletscher jährlich um etwa fünfzig Meter zurück.
Reaktion mit Verzögerung
Experten sind sich einig: Die Gletscher werden weiterhin Eis verlieren, selbst wenn die Erderhitzung nicht weiter fortschreitet: Denn sie reagieren mit Verzögerung auf den Temperaturanstieg. Die Gletscherschmelze hat direkte Auswirkungen auf uns Menschen und unsere Umwelt. Mit den Gletschern verschwindet die Artenvielfalt. Ehemalige Gletschertäler verwandeln sich in öde Gesteinswüsten, in denen sich nur wenige Lebewesen wohlfühlen.
Die Aufnahmen zeigen den Brandner Gletscher in den Jahren 2003 und 2015 (links: Alpenverein/Kaufmann, rechts: Alpenverein/Gross).
Höhere Temperaturen führen außerdem dazu, dass der sogenannte Permafrostboden auftaut. Rund ein Sechstel der gesamten Erdoberfläche gilt als Permafrostgebiet. Es zeichnet sich dadurch aus, dass der Boden dort mindestens zwei Jahre lang dauerhaft gefroren ist. Taut er auf, kann sich lockeres Gestein lösen und ins Tal stürzen. Forscher der ETH Zürich haben am Schweizer Aletschgletscher seit 2011 zahlreiche Felsstürze beobachtet – allein 2016 brachen 2,5 Millionen Kubikmeter Fels ab.
Wachsende & neu entstehende Gletscherseen
Ein unübersehbares Zeichen dafür, dass die Gletscher schmelzen, sind zudem wachsende oder neu entstehende Gletscherseen. Forscher entdeckten in den Schweizer Alpen 180 Gletscherseen, die allein im vergangenen Jahrzehnt entstanden waren. Tiefer liegende Gletscherseen können für ihre Umgebung eine Gefahr darstellen – der Druck kann dazu führen, dass Wände aus Geröll einstürzen und sich das Wasser ins Tal ergießt. Der Gletschersee Cachet in Patagonien löste bereits mehrere Fluten aus.
Fließt das Gletscherwasser ins Meer, trägt es dazu bei, dass der Meeresspiegel steigt. Forscher der ETH Zürich belegten im April 2019, dass die Gletscherschmelze den Meeresspiegel in den letzten Jahren im Schnitt um einen Millimeter ansteigen ließ. Dazu trugen besonders die Gletscher in Alaska, Patagonien und in den arktischen Regionen rund um den Nordpol bei. Jährlich verloren die 19.000 untersuchten Gletscher 335 Milliarden Tonnen Eis.
Gletscherschmelze kann aber auch zu Trockenheit führen. In manchen Gegenden – etwa in den Anden und dem Himalaya – sind Gletscher zeitweise die wichtigste Quelle für Trinkwasser.