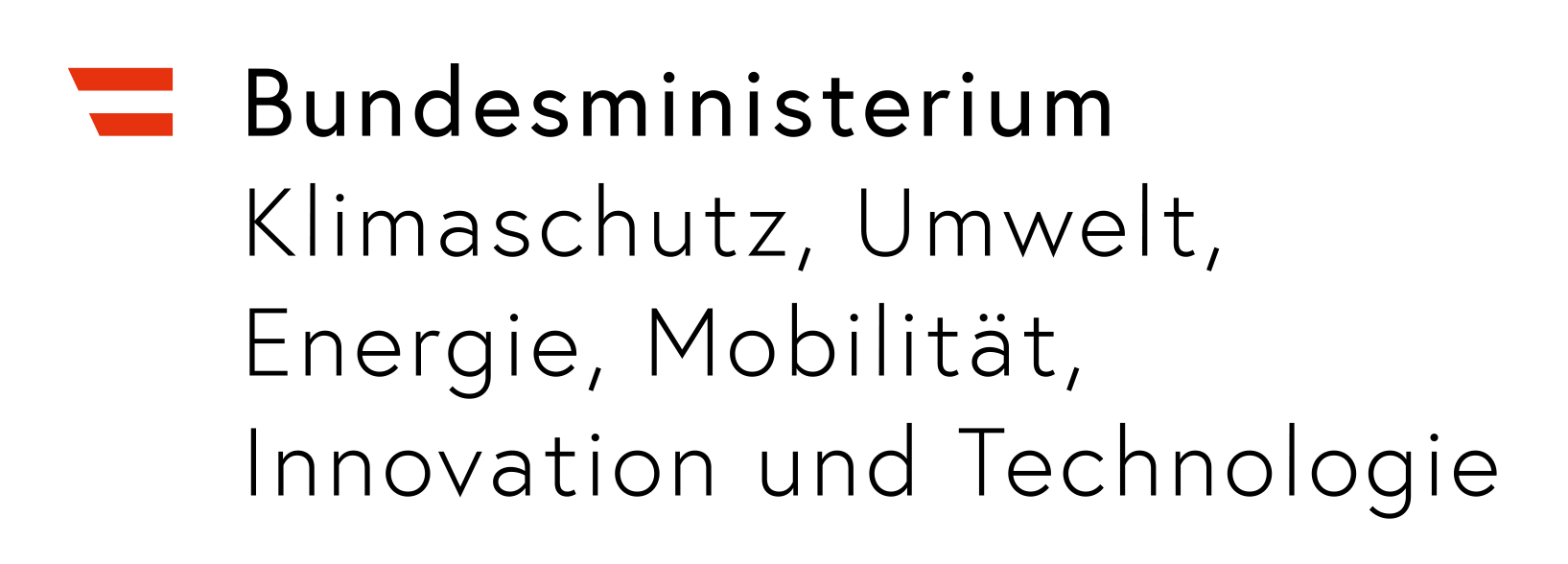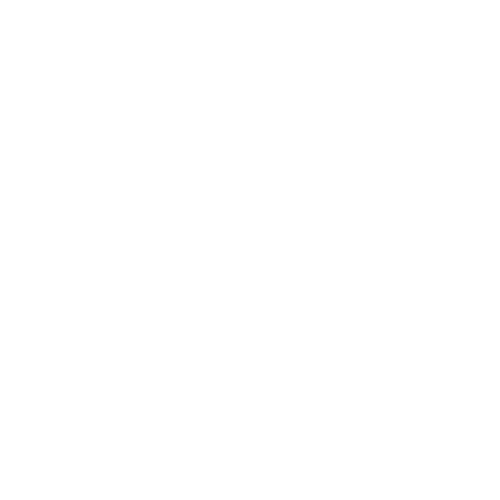Kategorie Innovation & Technologie - 14. Februar 2016
Innsbrucker Chemiker arbeiten an der künstlichen Photosynthese
Innsbruck – Ein Energieträger, der schadstofffrei verbrennt, zumindest in gebundener Form nahezu unbegrenzt vorhanden ist und eine durchaus hohe Energiedichte aufweist: Wasserstoff. Er kann viel besser gespeichert werden als elektrischer Strom, er kann Autos antreiben oder Energie in Brennstoffzellen freisetzen. Die Nutzung des Elements könnte in erheblichem Ausmaß dazu beitragen, dass die Welt unabhängiger von fossilen Brennstoffen wird. Weniger gut ist allerdings, dass heute noch an die 90 Prozent des gewonnenen Wasserstoffs aus Kohle, Erdgas und anderen Kohlewasserstoffen stammen.
Prozesse, die Wasserstoff in einfacher Weise aus Wasser abspalten, zählen deshalb zu den Hoffnungsträgern im Ringen um eine Energiewende. Die sogenannte photokatalytische Wasserspaltung, die 1972 von den japanischen Chemikern Akira Fujishima und Kenichi Honda entdeckt wurde, wäre wohl der eleganteste Weg: Die Energie der Sonne wird dabei genutzt, um einen elektrochemischen Prozess auszulösen, der Wasserstoff und Sauerstoff trennt. Pflanzen und Bakterien gehen ähnlich vor, wenn sie die elektromagnetische Energie der Sonne in chemische Energie umwandeln – ein Vorgang, der unter Photosynthese bekannt ist.
Die Suche nach alternativen Energiesystemen in den vergangenen Jahrzehnten hat der Entwicklung von Systemen zur photokatalytischen Wasserspaltung, die zu den künstlichen Photosynthesen gezählt wird, neue Konjunktur verliehen. Zu den Wissenschaftern, die dabei sind, den Prozess im Labor für eine künftige, großflächige Anwendung zu optimieren, zählt auch Christof Strabler.
Als Teil der Forschungsgruppe von Peter Brüggeller am Institut für Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie der Universität Innsbruck ist er am Projekt „Solarer Wasserstoff“ beteiligt. Die Forscher kooperierten bei dem im März 2016 auslaufenden Projekt mit dem Unternehmenspartner Verbund, unterstützt wurden sie von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG.
„Die ersten Versuche im Bereich der photokatalytischen Wasserspaltung bedienten sich seltener und teurer Elemente wie Palladium, um die Reaktion in Gang zu bringen“, erläutert Strabler. „Wenn man Wasserstoff aber irgendwann wirtschaftlich in großtechnischen Anlagen abspalten will, muss man zu günstigeren Metallen wechseln.“
Im großen Stil
Geringe Mengen der jeweiligen Metalle werden dabei gelöst ins Wasser gemischt und dem Sonnenlicht ausgesetzt. In der richtigen Kombination und unter passenden Bedingungen entsteht eine sogenannte Redoxreaktion, die eine Abtrennung des Wasserstoffs zur Folge hat. In Zukunft können spezielle Becken, die optimierte Metalllösungen enthalten, mithilfe von Spiegelsystemen hoher und fokussierter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, um die Reaktion im großen Stil durchzuführen. Mithilfe von Membranen kann das energiereiche Element dann eingesammelt werden.
Bei der Photosynthese der Pflanzen absorbiert der Farbstoff Chlorophyll Lichtenergie. Elektronen, die auf diese Art angeregt, also in einen energiereicheren Zustand versetzt wurden, werden abgegeben, die so entstandene chemische Energie dient zum Aufbau organischer Verbindungen, die energiereicher sind als die Ausgangsstoffe.
Bei der photokatalytischen Wasserspaltung, an der Strabler und Kollegen arbeiten, tritt Kupfer an die Stelle des Chlorophylls. Das Metall übernimmt die Aufgabe eines sogenannten Chromophors, eines Stoffs, der bestimmte Wellenlängen des Lichts absorbiert. „Der Kupfer-Komplex absorbiert nicht nur wenige Wellenlängen, sondern einen breiten Bereich des Lichtspektrums. Er kann Energie lang speichern, um sie dann weiterzugeben“, so Strabler.
Der Chromophor gibt die Energie gepaart mit den Elektronen an einen Katalysator – in diesem Fall Eisen – weiter, was die Reaktion zur Trennung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff auslöst. „Es nützt nichts, wenn man zwei Stoffe verwendet, die jeweils für sich perfekte Eigenschaften haben. Sie müssen im Zusammenspiel gut funktionieren. Eisen und Kupfer passen gut zusammen. Eisen und Nickel beispielsweise weniger.“
Um die Mechanismen der Redoxreaktion, die dem Vorgang zugrunde liegt, besser untersuchen zu können, wechselte Strabler im Rahmen eines Stipendiums an die Universität Strasbourg in Frankreich. „Ich konnte dort Untersuchungen mit hochspezialisierten Instrumenten machen, um mehr über die Wechselwirkungen der Metalle herauszufinden.“
Vorbild Natur
Allerdings ist es nicht einfach, das System letztendlich tatsächlich so auszutarieren, dass es so gut wie bei den Vorbildern in Pflanzen oder Bakterien funktioniert. „Die Natur ist ein lebendiger Kreislauf, der sich ständig regeneriert. Will man den Prozess reproduzieren, muss die Stabilität viel höher sein“, erklärt der Chemiker.
Höhere Stabilität bedeutet, dass der Prozess nicht nur stunden- oder tageweise in Gang bleibt, sondern Wochen und Monate. Strabler: „Bisher funktioniert es im Labor und in kleinen Anlagen. Bis die photokatalytische Wasserspaltung in großtechnischen Anlagen funktioniert, dauert es aber sicher noch 20 bis 30 Jahre.“ (Alois Pumhösel, 13.2.2016)