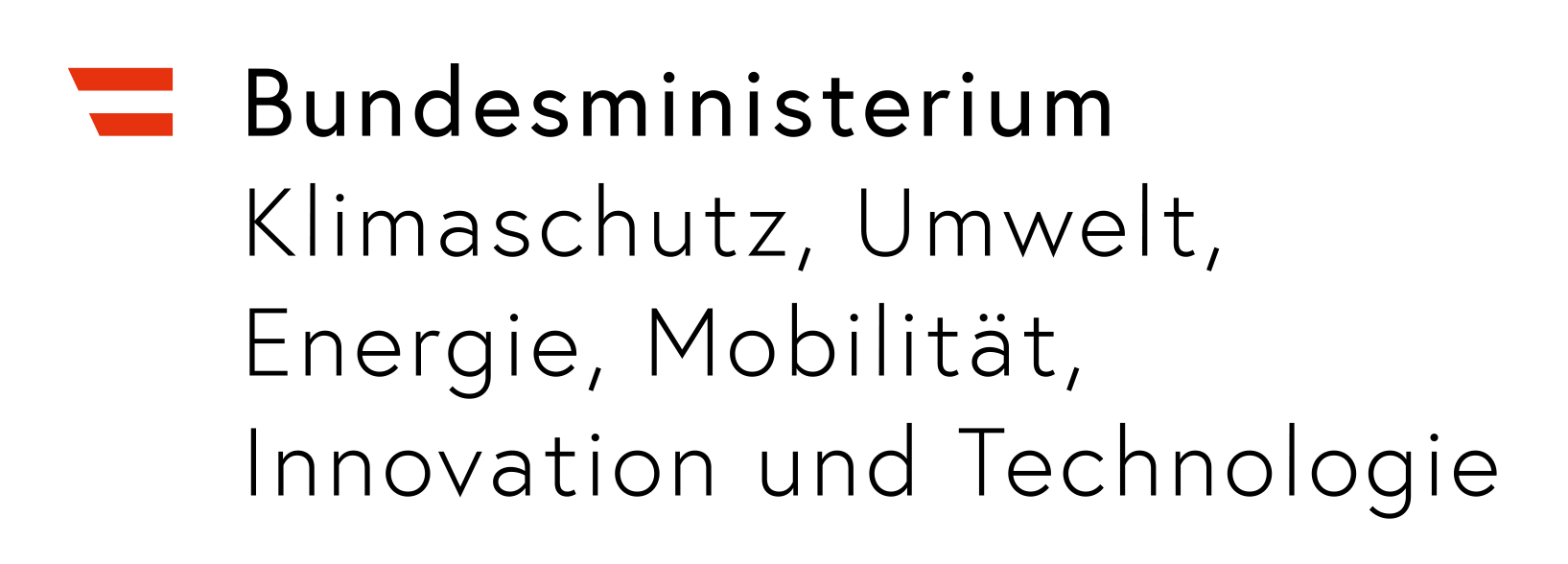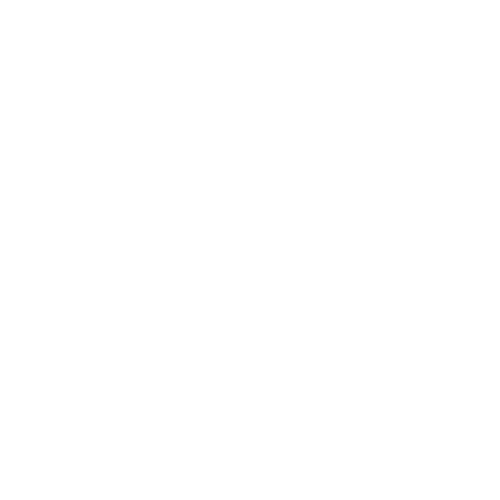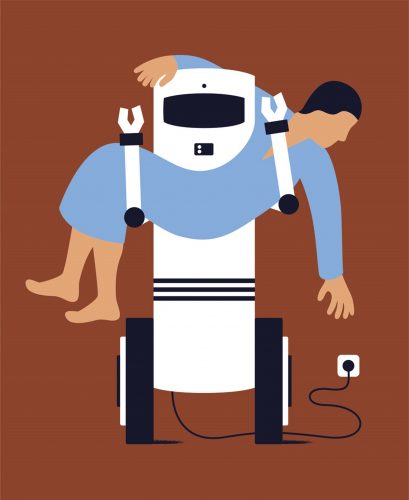14. Oktober 2019
Weniger Wunden & Virtual Reality: Die Zukunft der Roboter-OP
Seit 20 Jahren arbeitet sich Da Vinci in die Operationssäle vor: Rund 4.500 dieser OP-Roboter sind weltweit im Einsatz, in Österreich zehn. Vorteil sei die extreme Präzision, betonte Anton Ponholzer, Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Roboterchirurgie, kürzlich vor Journalisten. Durch Virtual Reality soll Da Vinci noch exakter werden, neue Technologie für weniger OP-Wunden sorgen.
Vor allem in der Urologie, der Chirurgie und Gynäkologie wird der OP-Roboter immer öfter eingesetzt, schilderte Urologe Ponholzer im Vorfeld der zweiten Fachtagung der Österreichischen Gesellschaft für Roboterchirurgie (ÖGR), die derzeit in Wien stattfindet. Am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien, wo Ponholzer seit Jahren mit Kollegen anderer Fachgebiete an der Weiterentwicklung der computerunterstützten Chirurgie arbeitet, werden etwa bösartige Erkrankungen der Prostata mittlerweile ausschließlich mit Da Vinci operiert. Bei bösartigen Erkrankungen der Niere sind es 90 Prozent.
Ursprünglich wollte das US-Militär mit roboterassistierter Chirurgie Ärzten das gefahrlose Operieren im Lazarett ermöglichen. Seit gut 20 Jahren wird Da Vinci, der derzeit einzige am Markt verfügbare OP-Roboter, in Krankenhäusern eingesetzt. Neben einer 3-D-Kamera verfügt der Roboter über drei Arme mit winzigen Operationsinstrumenten, von der Pinzette bis zur Schere. Gesteuert wird Da Vinci vom Chirurgen mit Händen und Füßen über eine Konsole, die Instrumente werden über Zugänge mit acht Millimeter Durchmesser eingeführt.
Absolut ruhiges & präzises Steuern der Instrumente
Die Visualisierung sei extrem gut, der Roboter ermögliche ein sehr ruhiges und präzises Ansteuern der Instrumente, die im Gegensatz zu anderen minimalinvasiven Techniken auch „ohne kunstvolle Verrenkungen“ in alle Richtungen gesteuert werden, schilderte Ponholzer. Zusätzlich können etwa fluoreszierende Moleküle gespritzt werden, um zu erkennen, wo sich durchblutetes Gewebe befindet oder durch Einbringen eines Ultraschallkopfes Gewebegrenzen besser erkannt werden. „Man kann diagnostisch und technisch wesentlich feiner arbeiten“, fasst er zusammen.
Billig ist der Einsatz des Roboters nicht: 1,8 Millionen Euro kostet die Anschaffung, dazu kommen ein Servicevertrag und die laufenden Kosten für Operationsinstrumente wie Scheren und Pinzetten, die nach zehn Einsätzen ersetzt werden müssen. Ponholzer schätzt die Mehrkosten im Vergleich zu einer offenen oder laparoskopischen Operation zwischen 1.000 und 2.000 Euro.
Vorteile für Patienten
Die Befürchtung, dass die Technologie auch in Feldern eingesetzt wird, wo sie nicht wirklich sinnvoll ist, um Patienten anzuziehen, kann Ponholzer grundsätzlich nachvollziehen. „In der Realität, so wie ich den Einsatz der Roboterchirurgie in Österreich wahrnehme, sehe ich diese Gefahr aber nicht.“ Abgesehen von den Kosten sei es so, dass mittlerweile medizinisch die Vorteile der Technologie überwiegen. Laut Metastudien könnten Patienten nach einer roboterassistierten Operation früher das Krankenhaus verlassen, hätten weniger Schmerzen, verlören weniger Blut und benötigten weniger Schmerzmittel und seltener Bluttransfusionen.
Ponholzer geht davon aus, dass die Vorteile der Technologie noch zunehmen werden. „Ich bin überzeugt davon, dass Roboterchirurgie die chirurgische Zukunft ist.“ Immerhin könne die Technologie immer weiterentwickelt werden und werde durch künftige Konkurrenzprodukte wohl auch günstiger und weiter verbreitet werden. Er rechnet etwa damit, dass die „Single Port Chirurgie“ marktreif werden wird, bei der man alle Instrumente nur noch durch eine einzige Öffnung in den Körper einführt und so nur eine kleine Narbe bleibt.
Er erwartet auch, dass schon bald Computertomografie- oder MR-Bilder von Tumoren in einer Art Virtueller Realität mit der 3-D-Sicht der Roboter-Kammer überlagert werden können und die Operateure so im Patienten noch besser navigieren können. Ähnliches passiere schon heute bei der Prostatabiopsie, wo Ultraschallbilder mit MR-Bildern fusioniert werden, um dann beim Eingriff genau zielen zu können.
apa