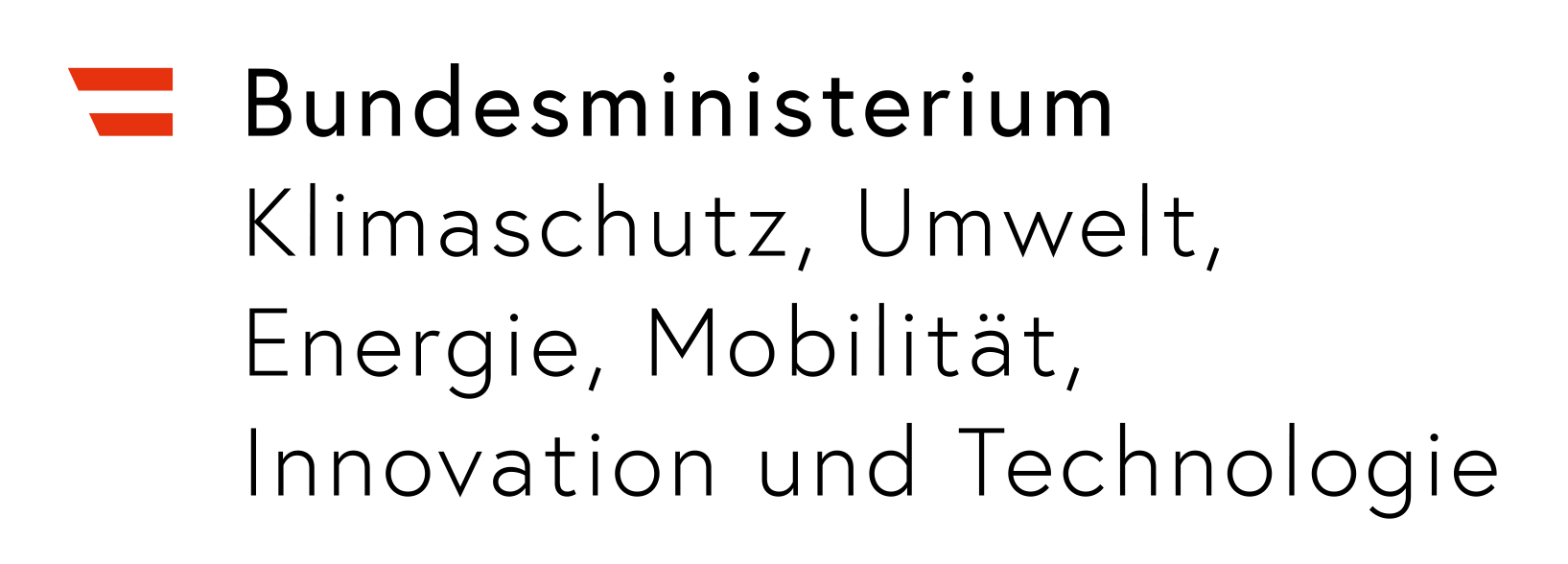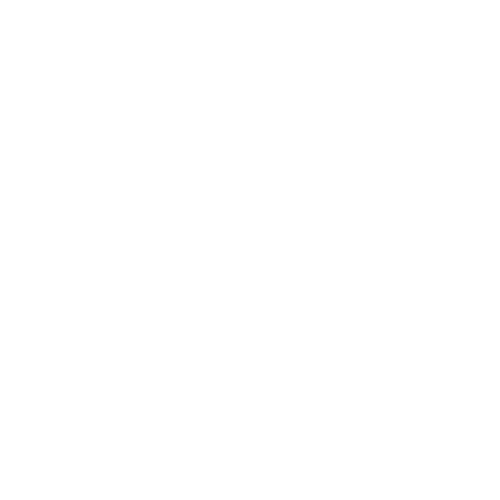Kategorie Innovation & Technologie - 24. Mai 2015
Forscherin Kansara: „Die Smart City ist ein Raum für Experimente“
STANDARD: Sie haben einmal einen TED-Talk in Klagenfurt gehalten. Dabei haben Sie das Publikum aufgefordert, Ihnen noch während des Vortrags zu twittern, wie die persönlich erträumte Smart City der Zukunft aussehen würde. Was kam dabei heraus?
Tia Kansara: Die Antworten waren sehr unterschiedlich. Aber es gab eine Gemeinsamkeit: Die Menschen im Publikum wünschten sich eine vernetzte und hochtechnologisierte Stadt mit viel Grün und einer hohen Lebensqualität.
STANDARD: Und wie sieht Ihre Vision einer perfekten Stadt aus?
Kansara: Wenn ich die Möglichkeit hätte, die perfekte Stadt zu designen, dann wäre das ebenfalls eine Stadt mit viel Grün und großem Alltagsangebot. Es wäre eine Stadt, in der man sich wohlfühlt, in der man sich gerne draußen auf der Straße aufhält, in der es leicht fällt, mit Menschen in Kontakt zu treten. Es wäre eine Stadt mit einer aktiven, verantwortungsvollen Community, die weiß, welche Potenziale die Stadt als sozialer Cluster birgt und wie diese bestmöglich zu nutzen sind.
STANDARD: Welchen Stellenwert hätte dabei die Technologie?
Kansara: Keinen augenscheinlich allzu hohen, wenn ich das so sagen darf.
STANDARD: Weil?
Kansara: Wir diskutieren sehr viel über die sogenannte Smart City. Aber meist wird die Smartness auf technische und technologische Aspekte reduziert. Das ist mir zu wenig. Ich warne davor, Smartness einzig und allein mit Technologie gleichzusetzen. Das ist ein zu kurzfristiges Denken.
STANDARD: Inwiefern?
Kansara: Ein Beispiel: In Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten gab es im Sommer 2014 so hohe Temperaturen und einen so hohen Kühlbedarf, dass das Elektrizitätsnetz aufgrund von Überlastung für einige Stunden ausgefallen ist. Die Folge war, dass die Stadt aufgehört hat zu funktionieren. Die Menschen sind daheimgeblieben, sie haben sich in ihre Autos gesetzt und haben ihre Klimaanlagen auf höchster Stufe laufen lassen. Das öffentliche Leben hat aufgehört zu existieren. Die Stadt war kaputt. Ist das smart? Ein anderes Beispiel: Nachdem im April 2010 in Island der Vulkan Ejafjallajökull ausgebrochen ist und Flugzeuge in ganz Europa wochenlang am Boden geblieben sind, hatte das eklatante Folgen im arabischen Raum. In Saudi-Arabien wusste man nach ein paar Tagen nicht, wie man an frische Nahrungsmittel gelangen soll.
STANDARD: Wo könnte man da ansetzen?
Kansara: Smartness bedeutet für mich, sich zu überlegen, wie man auch autonom funktionieren kann, und zwar ohne Gas aus Russland, ohne Nuklearstrom aus Frankreich, ohne Wasser aus den Alpen und ohne Nahrungsmittel aus Spanien und Südamerika. Da haben wir ja noch viel zu lernen. Und je mehr wir experimentieren, desto besser. Je schneller wir eine persönliche Erfahrung ermöglichen, desto schneller wird ein kulturelles Umdenken möglich sein. Smartness bedeutet für mich: Raum für Erfahrungen, Raum für Experimente.
STANDARD: Was halten Sie von ökologischen Vorzeigestädten wie etwa Masdar in Abu Dhabi?
Kansara: In gewisser Weise besitzen Stadtprojekte wie Masdar eine Art selbstimmanente Absurdität, weil sie so etwas wie eine Insel, wie eine wundersame Ausnahmeerscheinung in einem komplett konträren Umfeld sind, in dem ganz andere, oft sogar gegenteilige Spielregeln gelten. Das Resultat dieser Bemühungen ist bestenfalls ein angenehmes Mikroklima, vielleicht auch eine optimierte Mikroperformance im Bereich von Müllaufkommen, Grauenergiebedarf und CO2-Emissionen. In der ökologischen Gesamtbilanz einer Region jedoch hat so ein Projekt keinerlei Niederschlag. Ich sehe Masdar eher als Markenzeichen, als Werbeträger für eine Idee, für eine vorgelebte Vision der Stadt der Zukunft.
STANDARD: So gesehen bedeutet Masdar also viel Aufwand und wenig Nutzen?
Kansara: Kurzfristig betrachtet, ja. Langfristig betrachtet spielt Masdar eine wichtige Rolle, weil es den Menschen Möglichkeitsräume aufzeigt.
STANDARD: Wäre es möglich, das Geld in eine Aufklärungskampagne zu investieren, indem man die Menschen auffordert, ihre Häuser um zwei bis drei Grad weniger zu kühlen? Der Nutzen wäre höher, oder?
Kansara: Haben Sie spioniert? Genau das ist das Thema meiner Dissertation. Schon ein Grad Celsius würde ausreichen, um Großes in Gang zu setzen. Es gibt Studien in den USA, in Japan sowie im arabischen Raum, die beweisen, dass ein um ein Grad Celsius reduzierter Kühlbedarf in öffentlichen Gebäuden sowie in Wohn- und Bürohäusern massive Wechselwirkungen auslöst und je nach Klima den jährlichen Stromverbrauch um bis zu zehn Prozent reduziert. Bei um zwei bis drei Grad Celsius reduzierter Kühlung in Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln wäre die Energieeinsparung exponentiell höher.
STANDARD: Warum tun wir das nicht?
Kansara: Ich beschäftige mich intensiv mit dieser Frage. Die Antwort darauf ist diffizil, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Es geht um Aufklärung, es geht um die Hinterfragung von Erwartungshaltungen, es geht um die kulturelle DNA der Gesellschaft.
STANDARD: In Japan etwa hat man die sommerlichen Business-Kleidungs-Vorschriften neu definiert. Was war der Anlass dafür?
Kansara: Infolge des Reaktorunfalls in Fukushima ist es in Japan zu einem Energieengpass gekommen. Anstatt sich zu überlegen, wie man zu mehr Energie kommt, hat man sich in Japan darauf geeinigt, den kollektiven Energieverbrauch zu reduzieren. In diesem Zuge ist es zum sogenannten „Cool Biz“ gekommen, also zu einer gelockerten Business-Kleidungsvorschrift im Hochsommer, mit der es gelungen ist, den Konformismus im Büroalltag neu zu definieren und den Kühlbedarf in Bürogebäuden auf diese Weise zu reduzieren: kein Sakkozwang, kein Krawattenzwang, kein Kostümzwang für Frauen, Kurzarmhemd und kurzes Kleid okay. Ich finde diesen Schachzug genial.
STANDARD: Was können wir daraus für uns ableiten?
Kansara: Fukushima hat gezeigt, dass ein Umdenken möglich ist, wenn wir dazu gezwungen sind – sei es durch ein Unglück, sei es durch einen Ausfall von Ressourcen, sei es durch steigende Energiekosten. Jetzt geht es darum, sich zu überlegen, wie so ein Umdenken auch ohne vorherige Katastrophe möglich ist.
STANDARD: Haben Sie einen Vorschlag?
Kansara: Ich habe in Abu Dhabi Umfragen in 20 Bürogebäuden durchgeführt. Die gemessenen Innenraumtemperaturen haben zwischen 17 und 31 Grad Celsius variiert. 80 Prozent der Angestellten meinten, dass ihnen im Büro zu kalt ist. Viele würden es als Komfortgewinn erachten, wenn die Raumtemperatur um ein oder zwei Grad höher wäre. Das ist schon mal ein wichtiger Faktor. Der nächste Schritt wird sein, der Masse attraktive Anreize zum Umdenken anzubieten.
STANDARD: Welche wären das?
Kansara: Ich finde es absurd, dass wir Gebäude entwerfen, die zu jeder Jahreszeit genauso gut und genauso gleich perfekt funktionieren müssen. Schauen Sie sich einmal alte Bauernhäuser und alte Schlösser an! Da gibt es Räume und Bereiche, die eher für den Sommer, und solche, die eher für den Winter konzipiert waren. Auch im arabischen Raum gab es Bauten mit einer Differenzierung der Aufenthaltsqualität abhängig vom Wetter. Diese mikronomadische Kultur, dieses historische Erbe gilt es, wieder zu aktivieren.
STANDARD: Zurück zu den Wurzeln also?
Kansara: Ja. Es ist irritierend, aber wir müssen uns wieder das aneignen, was wir in den letzten hundert Jahren verlernt haben. (Wojciech Czaja, 20.5.2015)
Tia Kansara, geboren 1983 in Birmingham, Großbritannien, studierte Wirtschaft und Asian Studies an der School of Oriental and African Studies (SOAS) in London. Gemeinsam mit Rod Hackney gründete sie das auf nachhaltige Architektur und Stadtplanung spezialisierte Consultingunternehmen Kansara Hackney mit Sitz in London und Abu Dhabi. Sie war bereits für die UN tätig. Zuletzt hielt sie auf Einladung des Infrastrukturministeriums einen Vortrag bei der Smart Cities Week in Salzburg.