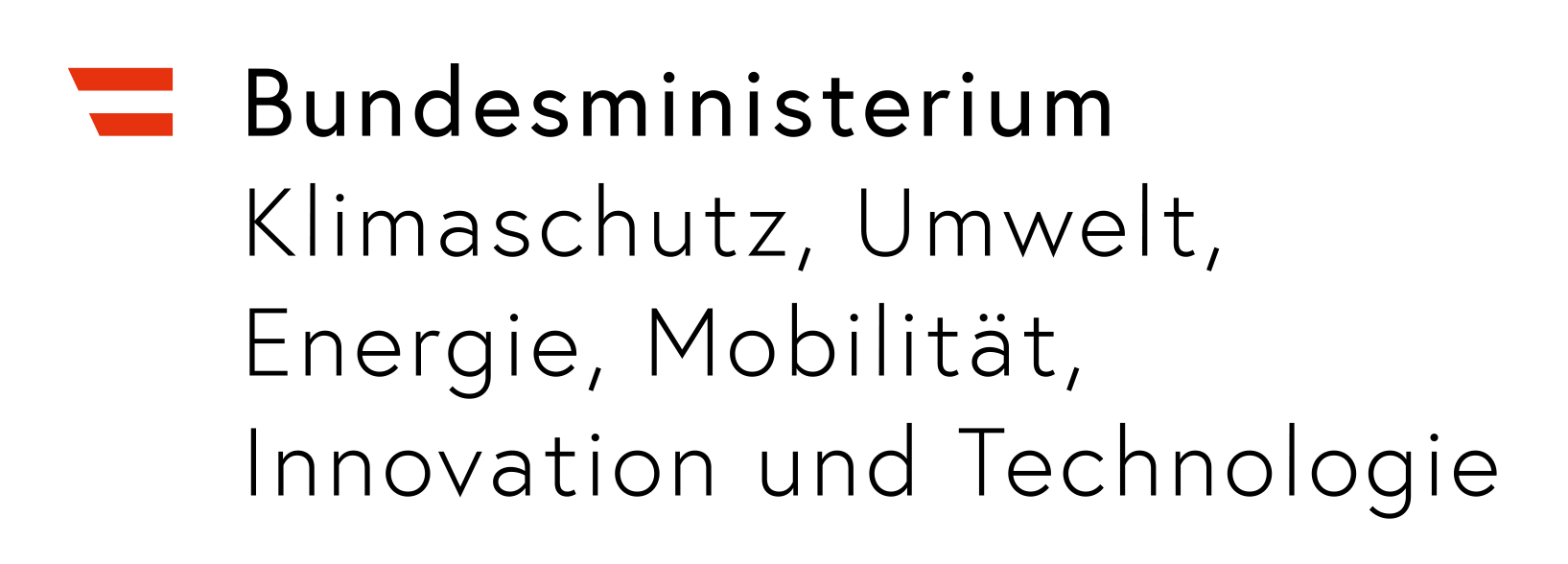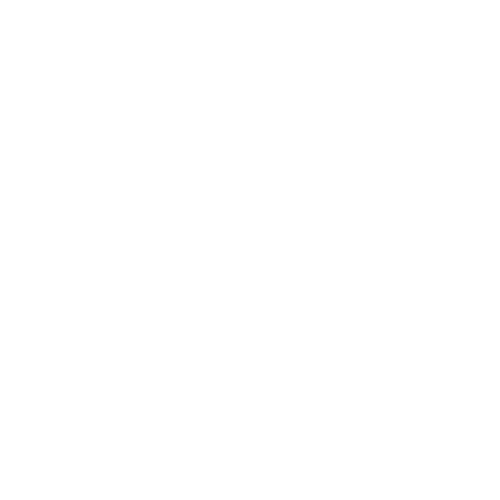Kategorie Innovation & Technologie - 25. August 2017
Auf Schrödingers Spuren
Von Juliane Fischer
„Außerirdische landen auf der Erde. Man schickt eine Sprachwissenschaftlerin und einen Physiker auf das Ufo, weil man annimmt, sie könnten am besten mit ihnen kommunizieren“, erzählt der junge Physiker Jakob Hinney vom Film „Arrival“. Er möchte Klischees zu seinem Fach aufzeigen: Der Physiker im Film kritzelt an die Tafel. Anstatt mit Menschen beschäftigt er sich mit Formeln, konkret mit der Schrödinger-Gleichung, die man oft in Filmen sieht. Hinney bezeichnet sie als das „Manifest der Quantenphysik“. Er ist selbst Physiker und nimmt mit einem Stipendium des Technologieministeriums am Europäischen Forum Alpbach teil. Jenem Ort, an dem Erwin Schrödinger, der Begründer der Quantenmechanik, begraben ist.
„Im Physikstudium kommt einem die Formel im zweiten oder dritten Jahr unter. In der Quantenphysik hat sie fast eine biblische Strahlkraft, als hätte Schrödinger sie auf den Steintafeln empfangen“, sagt Hinney. Sie habe aber nicht so eine populärwissenschaftliche Reichweite außerhalb der Physik wie beispielsweise Einsteins Relativitätstheorie: „Das ist eigentlich unfair.“ Hinney ist über Albert Einstein zur Physik gekommen. Mit 14 Jahren las er seine Biografie. Hinney selbst zog es in die Experimentalphysik. Und immer wieder ins Ausland: nach Kanada, China und Großbritannien. Für die Promotion wollte Hinney in eine große Stadt. Er schwärmt von Wien als „der besten Stadt, in der ich bisher gelebt habe“.
Mit Licht Informationen versenden
Er arbeitet an der TU Wien in einem kleinen Team an quantenoptischen Experimenten. Licht eignet sich gut, um Informationen zu versenden, doch es lässt sich schlecht speichern. „Wir versuchen es mit Glasfasern, also Kabeln für Licht“, erklärt Hinney. Eine Maschine erhitzt sie und zieht sie auseinander. Sie werden dünner als die Wellenlänge des darin geführten Lichts, das so nicht nur in der Faser, sondern auch außerhalb geführt wird. Die Herausforderung: das Licht gut mit der Materie zu koppeln und effiziente Licht-Materie-Schnittstellen herzustellen.
Fasernetzwerke gibt es schon. Unser Internet wird damit übermittelt. Geht es um große Datenmengen ist das der bessere Weg, meint der Physiker. „Ein YouTube-Video wird wahrscheinlich immer klassisch vermittelt werden.“ Der Quantenaspekt bringt erst einen Mehrwert, wenn man mit einzelnen Photonen arbeitet. Dann kann man gewisse Effekte der Quantenmechanik anwenden, etwa das Superpositionsprinzip, welches besagt, dass etwas gleichzeitig sowohl als auch sein kann, bis es jemand misst. Denn die Messung beeinflusst immer das Ergebnis. Genau das ist der Effekt, den die Quantenkommunikation nutzt. So sollen nämlich zwei Stellen Informationen austauschen können, die sonst niemand anders erhält.
Ein wichtiger Schritt hierfür ist die effiziente Kopplung der Photonen an Materie. In Hinneys Experiment sind das Cäsiumatome, die an der Glasfaseroberfläche festgehalten werden. In der Vakuumkammer bringt das Forscherteam die Atome mittels Laserkühlung auf millionstel Grad über den absoluten Nullpunkt. „Wir bauen eine Falle aus Licht, damit die Atome an die Faser gekoppelt sind“, sagt Hinney. Kontrollcomputer, Magnetspulen, Vakuumtechnologie, Lasertechnik: Hinney meint, nur etwa 20 Prozent seien wirklich Physik, der Rest Ingenieursarbeit. Das unterscheidet einen Experimentalphysiker vom Theoretiker.
„Leider finden viele Kollegen, ihre Forschung spreche für sich“, sagt Hinney. Er sieht das anders. „Natürlich sollte eine Forschungsgruppe mit der Website ebenso überzeugen, nicht nur mit der Forschung.“ Deswegen betreut er die Website seiner Abteilung. Dass man sich in seiner Disziplin festkrallt, dafür hat Hinney überhaupt nichts übrig. Ihn haben VWL und Politik schon immer interessiert. Einen seiner Helden, den US-Ökonomen Jeffrey Sachs, hat er im April für einen Vortrag an die TU Wien eingeladen. Hier in Alpbach diskutierte er beim Kamingespräch mit ihm. Das ist nämlich ein weiteres Klischee, gegen das er ankämpft: „Dass Physik eine tote Materie ist und wir nichts mit Menschen zu tun haben.“ Einem Physikerklischee kommt Hinney aber doch nicht aus: Er hört gern Heavy Metal.