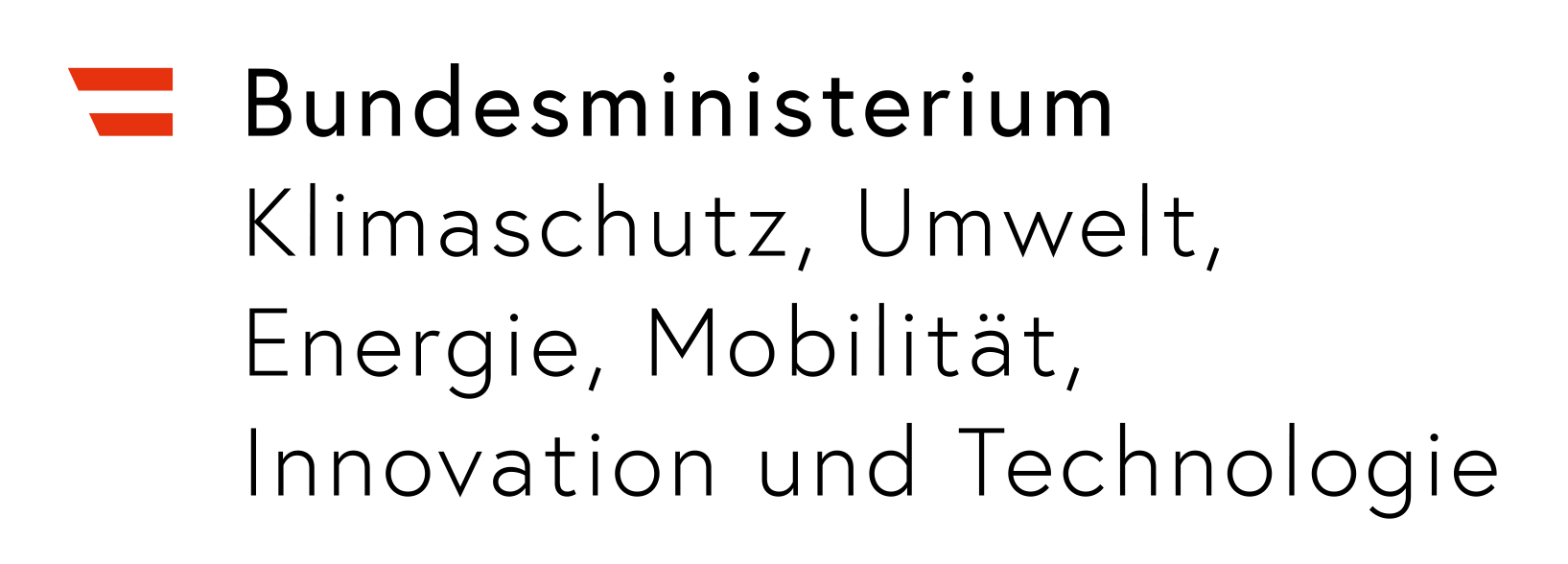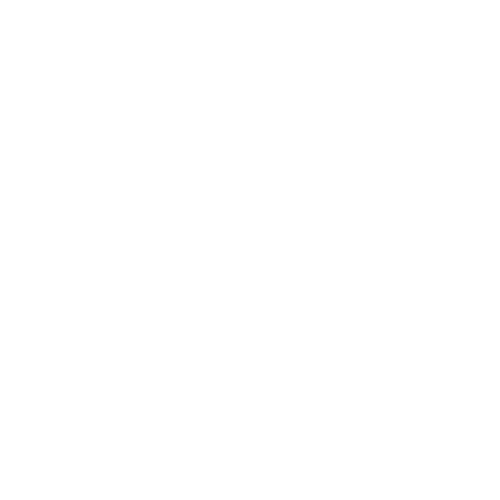Kategorie Innovation & Technologie - 24. Mai 2019
Das Internet der Dinge ist auch nur ein Mensch
Für Radu Grosu vom Institut für Computer Engineering der TU Wien ist das Internet der Dinge mit dem menschlichen Körper vergleichbar: Über die Haut erspürt man Druck und Temperatur. Muskelfasern, synchronisiert durch elektrische Wellen, lassen die Manipulation der Umgebung zu. Übersetzt in die Welt der cyberphysischen Systeme, werden Haut und Muskeln zu einer Vielzahl von Sensoren und Aktuatoren – zu einem wahren Schwarm kleinster elektronischer Systeme.
Ein Finger zuckt von der heißen Herdplatte intuitiv zurück. Ein Reflex, der nicht im Gehirn, sondern bereits in den Nervenzellen des Rückgrats ausgelöst wird. In den cyberphysischen Systemen übernehmen diese Funktion der ersten schnellen Datenverarbeitung und Rückantwort kleine Computer, die jeweils einen eigenen „Schwarm“ koordinieren.
Diese Minirechner umschreibt Grosu mit dem Begriff Fog. Denn sie sind den zentralen, leistungsstarken Cloud-Computern im Zentrum der Systeme – dem Gehirn in der Körpermetapher – vorgeschaltet. Im Gehirn wird die „Erfahrung“ der einlangenden Sensorwerte analysiert, Muster werden identifiziert und Schlüsse gezogen.
Im Rahmen des Projekts IoT/CPS Ecossystems arbeiten Grosu und Kollegen an der Etablierung großformatiger Systeme aus Schwarm, Fog und Cloud. Mit dabei sind das Austrian Institute of Technology (AIT) und das Institute of Science and Technology Austria (ISTA), Unterstützung kommt vom Wirtschaftsministerium. Das Projekt soll zudem helfen, die heimische Industrie zu vernetzen.
Systeme im Bereich intelligenter Gebäude, Mobilität und Produktion entstehen im Projekt. Im Bereich Smart Farming kooperieren die Forscher etwa mit Kollegen der Boku Wien, um Weinberge technisch aufzurüsten. Boden- und Atmosphärensensoren messen Feuchtigkeit und Temperatur, Luftdruck, CO2 und organische Teilchen im Umkreis der Weinstöcke.
Günstige Raspberry-Computer werden als Fog-Knoten konfiguriert, die Cloud dahinter ist ein System mit 88 Rechenkernen. „Damit können wir ein Modell des Weinbergs schaffen. Man kann verstehen, wie die Weinstöcke beeinflusst werden, Voraussagen treffen und Optimierungen vornehmen“, sagt Grosu.
Auch in der Stadt werden ähnliche Systeme angedacht. Beispielsweise könnte ein Sensornetz über ganz Wien ausgebreitet werden. Die Fog-Nodes würden in Verkehrsampeln untergebracht und jeweils hunderte Umweltsensoren im Umkreis von ein, zwei Kilometern kontrollieren. Ein Merkmal des Schwarms ist Redundanz. „Auch wenn ein Teil der Sensoren nicht richtig arbeitet, funktioniert dennoch das Gesamtsystem“, sagt Grosu. „Auch das Herz schlägt noch, wenn 40 Prozent der Herzzellen nicht mehr richtig funktionieren.“
Wenn das Holzhaus per App vor feuchten Balken warnt
Auch ein Holzhaus braucht Instandhaltung. Silikonfugen sollen erneuert, Filter getauscht werden. Künftig sollen Käufer eines Holzfertigteilhauses Zugang zu einer App bekommen, die an wichtige Tätigkeiten im Haus erinnert. Sensoren in der Holzkonstruktion melden dabei Daten wie Temperatur und Feuchtigkeit an das System, das dann Instandhaltungsempfehlungen abgibt.
Das ist eines der Szenarien, an denen Herwig Zeiner von der Forschungsgesellschaft Joanneum Research mit seinen Kollegen im Projekt DeSSnet arbeitet. Der Fokus der durch das Comet-Programm der Förderagentur FFG unterstützten Forschungen liegt auf der Schnittstelle, die die physische Welt für neuartige digitale Services zugänglich machen soll: drahtlose Sensornetzwerke, die Daten aufnehmen und an die digitalen Systeme weitergeben.
„Energieeffizienz und Interoperabilität sind die größten Herausforderungen bei der Gestaltung der Sensornetze“, erklärt Zeiner. Batterien müssen lange halten. Aufwendige Übertragungs- oder Verschlüsselungsmethoden sind dabei kaum praktikabel, dennoch muss entsprechende Sicherheit gewährleistet sein. Die Hardware der massenhaft eingesetzten Messpunkte muss zudem günstig bleiben. Besonders wirtschaftlich sei der Einsatz passiver RFID-Tags, die auf Entfernung ausgelesen werden und keine eigene Energieversorgung benötigen, hebt der Forscher hervor.
Wie Sensoren „organisiert“ werden können
Dazu kommt die Frage, wie die Sensoren in einem Netzwerkverbund organisiert werden können. „Der Vorteil einer Schwarmanordnung ist, dass Sensorknoten bei Überlastung Ausweichstrategien anwenden und etwa auch über einen Nachbarknoten kommunizieren können“, gibt Zeiner ein Beispiel. Zuletzt geht es im Projekt auch um die Analyse einlangender Sensordaten.
Artificial-Intelligence-Algorithmen kommen etwa zur Anwendung, um aufgrund der Messdaten Entwicklungen in ihrem zeitlichen Nacheinander besser abschätzen zu können – ein wichtiger Aspekt bei einer vorausschauenden Instandhaltung, die den reibungslosen Betrieb einer Anlage auf Dauer aufrechterhält. Zudem werden die Systeme auch für die Optimierung des Gesamtsystems genutzt – etwa um die Organisation einer Fertigungslinie zu verbessern.
Zeiner und Kollegen arbeiten im Rahmen des Projekts an mehreren konkreten Anwendungsfällen. Neben den Holzhäusern wird eine sensorgestützte, vorausschauende Instandhaltung auch bei Großmotoren, die Teil von Schiffen oder Industrieanlagen sind, implementiert. Die RFID-Technologie dagegen soll etwa in Motorprüfständen genutzt werden. Alle für die Tests notwendigen Werkzeuge und Prüfmittel werden mit Tags versehen, um sie auf einfache Weise jederzeit lokalisieren zu können – eine neue Form, nachhaltig Ordnung zu schaffen.
Nicht nur smart, sondern auch sehr verlässlich
In Produktionshallen sollten Transporteinheiten, Roboter und andere mobile Gerätschaften jederzeit sicher und genau lokalisierbar sein. Doch ein satellitennavigationsgestütztes System wie GPS kommt in Innenräumen kaum infrage. Eine gangbare Möglichkeit ist dagegen, ein eigenes Signal auszusenden, das von allen Wänden, Ecken und Objekten im Raum reflektiert wird. Nimmt man den Raumplan als Grundlage, kann man dank der Signalechos und deren Überlagerungen sehr genau die Position von Objekten errechnen.
Im Forschungszentrum Dependable Internet of Things, ein Leitprojekt der TU Graz, werden Signale in einem Ultrabreitband-Frequenzspektrum genutzt, um ein zuverlässiges Ortungssystem abseits der Verfügbarkeit von GPS & Co zu schaffen. Es ist ein Projekt unter vielen, die allesamt die Verlässlichkeit der vernetzten, smarten Dinge in den Fokus stellen. Sie sollen auch in sicherheitskritischen Systemen einsetzbar sein.
Das englische Dependability ist im Bereich Systems Engineering ein gut definiertes Konzept, das gewisse Eigenschaften beschreibt, die es für ein vertrauenswürdiges System braucht, erklärt Projektleiter Kay Römer vom Institut für Technische Informatik der TU Graz. Dabei geht es um Faktoren wie Verfügbarkeit eines Services, richtige und zeitnahe Beantwortung von Anfragen oder Schutz vor Manipulierbarkeit.
Neben der erwähnten Lokalisierung beschäftigen sich die Forscher mit Strategien, die eine verlässliche Zusammenarbeit von Systemen, das zuverlässige Steuern von Fahrzeugen und nicht manipulierbares Rechnen sicherstellen.
Dieselben Standards erfüllen
„Geräte verschiedener Hersteller arbeiten oft nicht gut zusammen, obwohl sie dieselben Standards erfüllen, diese aber unterschiedlich implementiert wurden. Ursprünglich haben wir uns im Projekt angesehen, wie man eine Garantie abgeben kann, dass diese Systeme dennoch problemlos interagieren können“, erläutert Römer. Die Wissenschafter bombardierten die Schnittstellen mit Anfragen und konnten so Problemfälle genau identifizieren.
Ein ähnliches Prinzip wenden die Forscher auch in einem Projekt an, das sich mit der Kommunikation von Lkws beim Platooning beschäftigt. Dabei wird nur noch das erste Fahrzeug einer Kolonne von einem menschlichen Fahrer gelenkt, die weiteren folgen in knappem Abstand dank autonomer Fahrsysteme. Die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen darf sich dabei keinesfalls verzögern oder gar abbrechen.
„Wir weisen nach, dass es durch Fehlimplementierungen nicht zu Unfällen kommen kann“, sagt Römer. Mithilfe von maschinellen Lernverfahren wird das Verhalten der Fahrzeuge – und wie es zu brenzligen Situationen kommen kann – exakt beschrieben. Daraus werden Testfälle generiert, anhand deren die Steuerungssysteme wiederum lernen, gefährliche Situationen vorherzusagen und letztendlich zu verhindern.
Alois Pumhösel, DerStandard
Wissen: Die Vernetzung der physischen Welt
Seit mehr als einem Jahrzehnt wird nun die Vision eines zukünftigen Internets der Dinge propagiert. Fitnessarmbänder samt Health-Apps sowie vernetzte Wohnungen mit automatisierten Geräten und gestreamter Unterhaltung sind längst keine Zukunftsmusik mehr. Sie gehören zu dem Internet der Dinge (IoT – von englisch: Internet of Things), also zur virtuellen Vernetzung realer Gegenstände mithilfe von Sensoren, die unsere Technikzukunft prägen sollen – im industriellen Bereich ist die Entwicklung schon weit fortgeschritten.
Im deutschsprachigen Raum wurde das Prinzip unter dem Begriff Industrie 4.0 vorangetrieben, unter dem verschiedene Veränderungen in der Produktion zusammengefass werdent, die zusammengenommen die Art, wie wir produzieren und arbeiten, völlig verändern.
Klassische Produktion verschmilzt mit digitalen Technologien. Menschen, Werkstoffe, Produkte und Maschinen kommunizieren in komplexen Systemen miteinander: von einer weiteren industriellen Revolution ist die Rede. Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) fördert die industrielle Wende jährlich mit 185 Millionen Euro.
Parallel bildet der Begriff der cyberphysischen Systeme, in denen Elektronik, Mechanik und Informatik zusammenfließen, die technologische Entwicklung ab. An der Entstehung eines Internets der Dinge hat eine ganze Reihe aktueller Technologien Anteil: neuartige Sensorsysteme, neue Netzwerkprotokolle und verteiltes Rechnen, die Analyse großer Datenmengen und das Erkennen von Datenmustern durch maschinelles Lernen und Artificial Intelligence. Autos, Produktionshallen, Energienetze und Gebäude sind zunehmend von diesen Systemen durchdrungen.