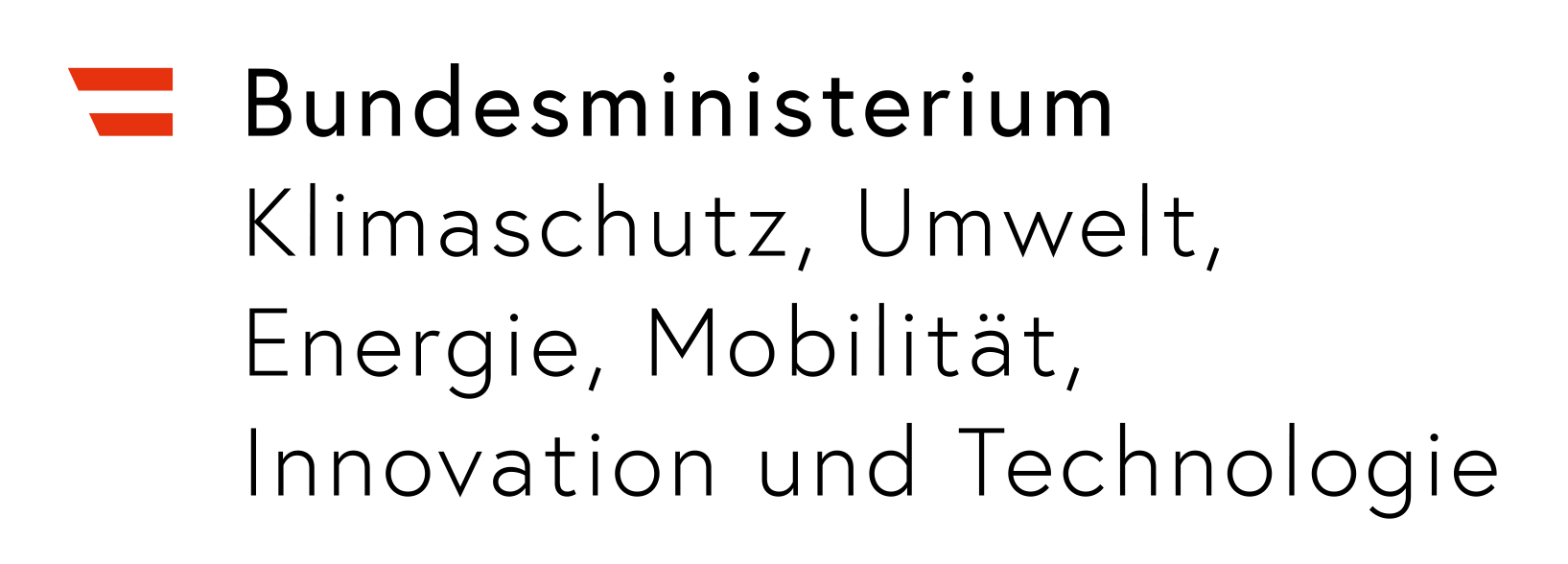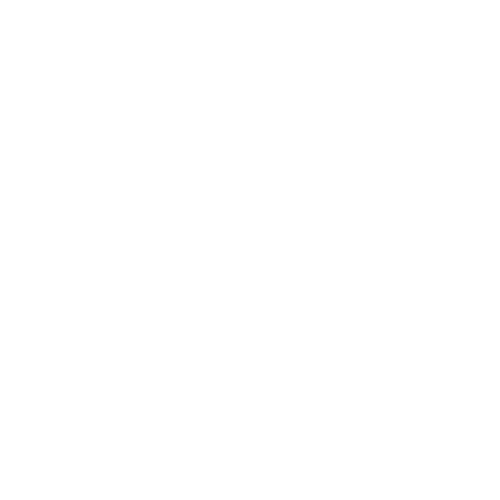Kategorie Innovation & Technologie - 30. Oktober 2015
Die Vermessung der Energieeffizienz
Wien – Der Energieausweis, der seit 2007 für Gebäude in Österreich Pflicht ist, beinhaltet eine ganze Reihe von Daten und Kennzahlen. Bei Wohngebäuden sind etwa detaillierte Darstellungen des Heizwärmebedarfs, des Warmwasserwärmebedarfs, des Heizenergiebedarfs, ein Gesamtenergieeffizienzfaktor und noch viele andere Erhebungen notwendig. Natürlich gehören auch die CO2-Emissionen dazu. Viele Berufsgruppen sind berechtigt, diese gerne als „Typenschein“ für Gebäude bezeichneten Dokumente zu erstellen, neben Architekten, Ziviltechnikern und Baumeistern etwa auch Zimmerermeister, Elektrotechniker oder Heizungssanitär- und Lüftungstechniker.
Man wird zwar ohne Einberechnung des Nutzerverhaltens keine Aussagen über zukünftige Heizkosten treffen können. Die Bewertung von Faktoren wie Gebäudegeometrie, Dämmung und Heiztechnik soll aber zumindest einschätzen lassen, dass ein mit „A++“ bewertetes Gebäude im Vergleich zu „A“ relativ weniger Energie verbraucht.
„Der einzige Sinn eines Energieausweises ist, Gebäude vergleichbar zu machen“, sagt Bernhard Sommer von der Abteilung Energiedesign am Institut für Architektur der Universität für angewandte Kunst Wien. Und gerade dieser Sinn, die Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit der Energieausweise, scheint nicht immer gegeben zu sein, sagt er. Die Richtlinien und Leitfäden, auf die sich die Ausweisersteller stützen, seien letzten Endes zu ungenau.
In dem vom Verkehrsministerium und der Förderagentur FFG unterstützten Projekt Eden („Development of a structured data and preparation documentation with a minimized error-proneness for energy performance cerificates“), das Sommer leitet, soll nun eine Strategie gefunden werden, wie die Mängel und Beliebigkeiten bei der energetischen Einschätzung nachhaltig behoben werden könnten. Gerade bei den Bewertungen von Altbauten gebe es Probleme: „Derzeit ist die Situation so, dass es vor allem im Altbestand sehr große Interpretationsspielräume gibt, wie man Bauteile einschätzt“, sagt Sommer. Die Erfassung der Gebäudegeometrie erfolge etwa teilweise sehr akribisch per 3-D-Modell, teilweise aber wenig genau, allein auf Basis der Grundrissdaten.
Das Schätzen alter Mauern
Die einen nehmen für die Bewertung einer Mauer eines Hauses aus der Gründerzeit einen sogenannten Default-Wert her: einen vorgegebenen Wert, der alleine von der Dekade abhängt, in dem das Gebäude errichtet wurde. Andere schätzen den Wärmedurchgang des Ziegelwerks, kombinieren ihn mit der Mauerdicke und können damit sogar näher an der Realität liegen als mit den ungenauen Default-Werten, erläutert Sommer die Problematik.
Wurde bei aneinanderstehenden Gebäuden, die durch die verbindende Mauer keine Energie verlieren sollten, auch die unterschiedliche Giebelhöhe berücksichtigt? Wurde recherchiert, ob das oberste Geschoß des Nachbarhauses beheizt oder ein ungenutzter Dachboden ist? Es gibt viele Quellen für Ungenauigkeiten.
„Bei älteren Bauwerken ist das alles mehr oder weniger geschätzt. Erst ab den 1970er-Jahren beginnt die Plandokumentation einigermaßen vollständig zu werden. Es gibt Informationen zu Materialien und Details zum Aufbau der Bauteile“, erklärt Sommer. „Bis in die 1990er-Jahre fehlen aber weiterhin Darstellungen, die man benötigen würde, etwa Details zu den Fensterflächen. Erst seit gut 20 Jahren ist die Informationslage wirklich gut.“
Im Zuge des einjährigen Forschungsprojekts wollen Sommer und Kollegen zuerst einmal klären, ob die Ungenauigkeiten tatsächlich so relevant sind. „Jeder Energieausweis-Ersteller kommt zu einer anderen Zahl. Die Frage ist, wie groß die Unterschiede sind, ob sie die Einschätzung stark verzerren oder es ohnehin nur ein paar Prozent sind“, sagt Sommer. Darüber hinaus soll herausgefunden werden, welche Eingabedaten besonders sensibel sind. Naheliegend sei, dass die Kennzahl der Kompaktheit eines Gebäudes, also die Oberfläche der Gebäudehülle, dividiert durch das beheizte Volumen, hier große Bedeutung hat. Sommer: „Je kleiner ein Gebäude, desto mehr verbraucht es an Energie, desto mehr Wärme kann pro Kubikmeter entweichen.“
Besser planen
Der nächste Schritt sei dann zu einer neuen Eingabedatendokumentation zu finden: einer Empfehlung, wie Daten aufbereitet werden sollen, damit diese möglichst vergleichbar bleiben. „Je nach Größe und Baujahr sollen Hinweise entstehen, worauf man besonders achten muss.“ Zudem wäre es möglich, beispielsweise eine Messserie für Ziegel aus der Gründerzeit durchzuführen, um genauere Werte zu bekommen.
Gleichzeitig sollen Kennzahlen ermittelt werden, die helfen, schon früh in der Planung eines Hauses die richtigen Entscheidungen in Sachen Energieeffizienz zu treffen, meint Sommer. „Beispielsweise ist es schwierig, die Auswirkungen von Verglasungen einzuschätzen. Auf der falschen Gebäudeseite führen sie zu großen Wärmeverlusten, auf der richtigen zu einer Reduktion des Heizenergiebedarfs. Das lässt sich aus den Kennzahlen derzeit nicht herauslesen.“
Im Zuge des Projekts wird eine Datenbank mit zahlreichen 3-D-Modellen von Gebäuden aufgebaut. So können die verschiedenen Unschärfeszenarien durchgespielt werden. Die Daten werden automatisiert in ein Evaluierungsprogramm eingelesen und ausgewertet.
Obwohl erst wenige Jahre im Gebrauch, sei die Darstellung der Energieausweise bereits sehr komplex und wenig benutzerfreundlich geworden, kritisiert Sommer. Das Projekt Eden soll dem entgegensteuern: Es soll Hinweise geben, wie das Regelwerk differenzierter, die Präsentation aber einfacher werden könnte. (Alois Pumhösel, 30.10.2015)