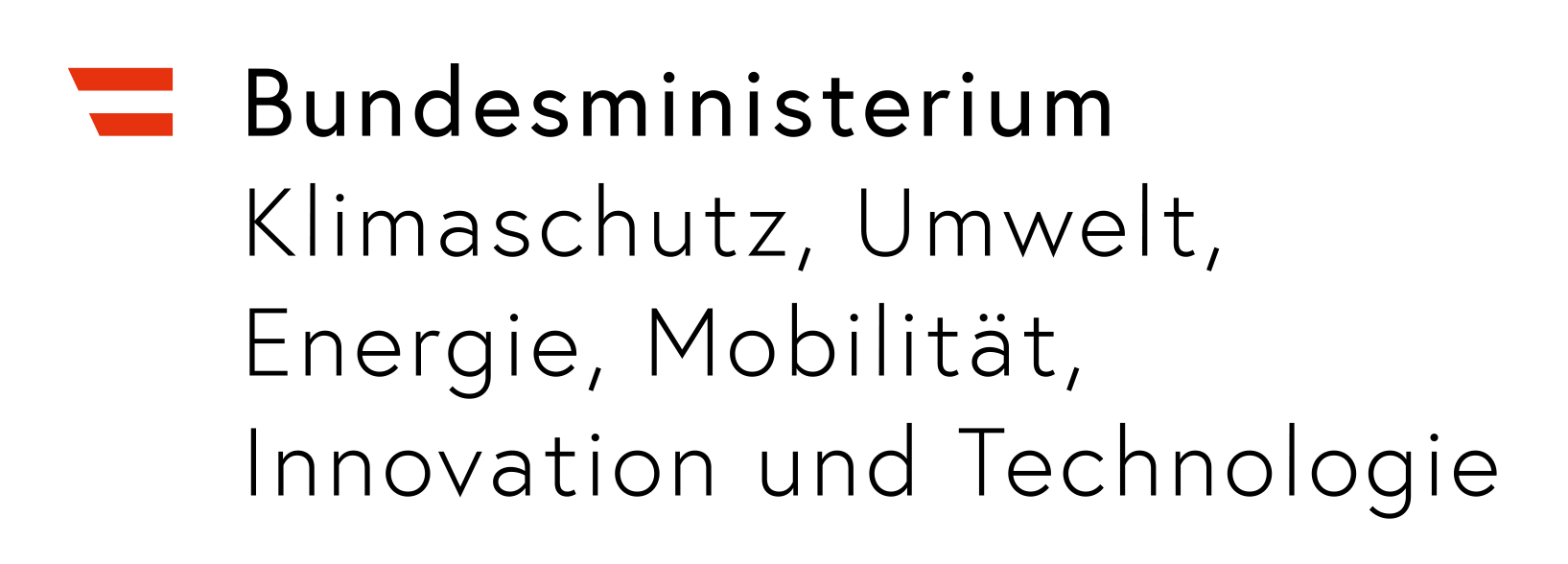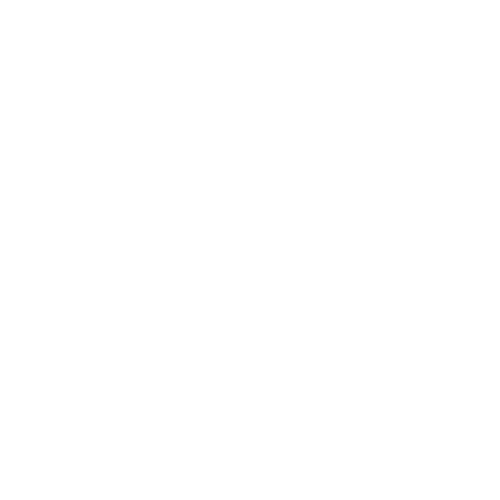Kategorie Innovation & Technologie - 28. März 2022
ESA geht mit Satelliten auf Plastikjagd im Meer
Millionen Tonnen von Müll landen jährlich in Flüssen und Ozeanen. Ein globales Monitoring fehlt jedoch. Das will die Raumfahrtagentur ESA ändern
Als der Abenteurer Victor Vescovo im Mai 2019 den Grund des Marianengrabens in exakt 10.928 Metern erreicht, macht er eine irritierende Entdeckung. Die Kamera des U-Boots filmt dort, wo noch nie ein Mensch gewesen ist, ein Stück Müll. Bereits ein Jahr zuvor hatte ein japanisches Forschungsteam in einer Datenbank von Tiefseeaufnahmen Ähnliches gefunden: einen Plastiksack, abgesunken an den tiefsten Punkt der Erde.

Plastikmüll ist mittlerweile selbst im entlegensten Winkel zu finden. Wie und wo der schwimmende Abfall genau zirkuliert, will die ESA mithilfe von Satelliten herausfinden. © Greg Martin/surfers against sewage
Zehn bis 14 Millionen Tonnen Plastik landen Schätzungen zufolge Jahr für Jahr in den Ozeanen. Über Wind und Meeresströmungen wird das Material in entlegenste Winkel der Erde transportiert. Nicht immer sammelt sich der Müll in riesigen Strudeln gut sichtbar an der Wasseroberfläche oder wird an der Küste wieder an Land gespült. Viel Plastik landet im Magen von Meeresbewohnern, sinkt in die Tiefe oder wird durch die Naturgewalten so weit zerkleinert, dass es als Mikroteilchen für den Menschen unsichtbar wird.
Kaum verlässliche Daten
Forschende, die Lösungsansätze für die Plastikproblematik entwickeln wollen, stehen damit vor einem Grunddilemma. „Die zur Verfügung stehenden Daten sind sehr rudimentär. Wir wissen vielleicht von einem Prozent des im Meer landenden Plastiks, was mit ihm geschieht“, sagt Strömungsexperte Anton de Fockert vom niederländischen Forschungsinstitut Deltares im Gespräch mit dem STANDARD.
Weder gebe es verlässliches Datenmaterial, woher der Großteil der Verschmutzung stamme, noch, wie die tatsächlichen Transportwege über Flüsse, aber auch in den Ozeanen im Detail aussehen.
Die Europäische Weltraumorganisation ESA, zu der auch Österreichs Klimaschutzministerium jährlich finanzielle Beiträge leistet, will dies zusammen mit zahlreichen Projektpartnern ändern. Aus einem Aufruf im Jahr 2020 sind mehr als zwei Dutzend Projekte entstanden, die im Rahmen der Open Space Innovation Platform (OSIP) gezielt an der Erkennung von schwimmendem Müll von oben arbeiten. Um diesen aufzuspüren und auf seiner Reise rund um den Globus zu beobachten, sollen neben Flugzeugen und Drohnen künftig auch Satelliten zum Einsatz kommen.
Viele Herausforderungen
„Ölteppiche, aber auch Ansammlungen wie Sandsedimente oder Chlorophyll im Wasser zu dokumentieren funktioniert aus dem All schon sehr gut. Unser erklärtes Ziel ist es, ein Monitoring-System zu schaffen, mit dem die globalen Plastikkreisläufe abgebildet werden können“, sagt ESA-Ingenieur Peter de Maagt.
Doch der Weg dorthin birgt viele Herausforderungen. „Plastik kommt in jeder erdenklichen Größe und Form im Meer vor. Systeme auf eine zuverlässige Erkennung zu trainieren ist keine leichte Aufgabe“, sagt de Fockert. Experimentiert wird mit allem, was moderne Sensortechnologien zu bieten haben: hochauflösenden optischen Kameras, aber auch Messungen im UV-, Infrarot- und Mikrowellenbereich.
Experimente im Versuchsbecken
Während Erstere bei entsprechender Auflösung für besonders detaillierte Informationen sorgen, machen die dabei anfallenden enormen Datenmengen eine Auswertung schwierig. Ein anderer, weniger datenhungriger Ansatz ist folglich, die Wasseroberfläche mit Radiowellen zu scannen. „Wenn Wasser mit einem Fremdkörper wie schwimmendem Plastikmüll interagiert, sollte ein funkwellenbasiertes System ein anderes Signal empfangen, als wenn nur Wasser vorgefunden wird.
Auf diese Weise könnte das Plastik im Meer ebenfalls aufgespürt werden“, sagt de Maagt. Um ihre theoretischen Lösungsansätze zu überprüfen, steht den Forschenden mit dem „Atlantic Basin“ des Deltares-Instituts ein beeindruckendes „Labor“ zur Verfügung. Das 75 Meter lange und neun Meter breite Becken in der Nähe der niederländischen Stadt Delft wird normalerweise genutzt, um Wellenbewegungen und ihre Auswirkungen auf den Meeresgrund zu simulieren – etwa um die hydraulischen Komponenten von Wellenkraftwerken oder die Statik von Offshore-Windanlagen zu testen.
Unterschiedliche Wellenbedingungen
In mehreren Experimenten mit schwimmendem Plastikmüll konnten die Forschungsteams nun beweisen, dass die Systeme diesen im Wasser tatsächlich entdeckten. Um möglichst realistische Bedingungen zu simulieren, verwendeten die Forschenden echten Müll, der zuvor aus dem Meer gefischt worden war: Taschen, Flaschen, Netze, Seile, Plastikgeschirr, Styropor sowie weitere typische Müllreste abseits von Plastik wie Zigarettenstummel. Neben stiller See wurden auch unterschiedliche Wellenbedingungen erzeugt.
„Da die Experimente im Versuchsbecken so vielversprechend verlaufen sind, geht es im nächsten Schritt darum, die unterschiedlichen Systeme und Technologien in der freien Natur zu testen“, sagt ESA-Ingenieur de Maagt. Um die optimalen Sensoren und Funkfrequenzen zu finden, sollen zunächst Drohnen und Flugzeuge zum Einsatz kommen. Schon in einem bis eineinhalb Jahren könnten die Systeme dafür bereit sein. Am Ende der Entwicklung steht der Einsatz in Satelliten.
Kombination von Technologien
Im besten Fall könnten bestehende Satellitensysteme so adaptiert werden, dass sie die Suche von Plastikmüll aus dem All mitübernehmen können. Welche Technologie sich schließlich durchsetzen wird, steht laut de Maagt aber buchstäblich noch in den Sternen.
Auch eine Kombination – etwa von Mikrowellentechnologie und optischen Sensoren – sei denkbar. „Mit Radiowellen könnten wir schnell Anomalien auf der Wasseroberfläche erkennen. Um diese Auffälligkeiten genauer zu überprüfen, könnten dann gezielt optische Technologien zum Einsatz kommen“, sagt de Maagt.
Wie man das gefundene Plastik letztlich wieder aus dem Wasser und damit aus dem Nahrungskreislauf bekommt, ist eine andere Frage, die ebenfalls alles andere als trivial ist. Das zeigen Projekte wie das 2013 vom damals 18-jährigen Niederländer Boyan Slat ins Leben gerufene „Ocean Cleanup“. Das schwimmende System, das unter anderem den riesigen Müllstrudel im Nordpazifik säubern soll, hatte in den vergangenen Jahren mit diversen Rückschlägen zu kämpfen und befindet sich weiterhin im Teststatus.
Für den Strömungsforscher de Fockert ist dennoch klar: „Ein globales Monitoring-System, das uns zeigt, woher wie viel Müll kommt und wohin dieser schwimmt, ist die Grundvoraussetzung, um effiziente Lösungen zu entwickeln und deren Wirksamkeit zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen zu können.“
Martin Stepanek / DER STANDARD