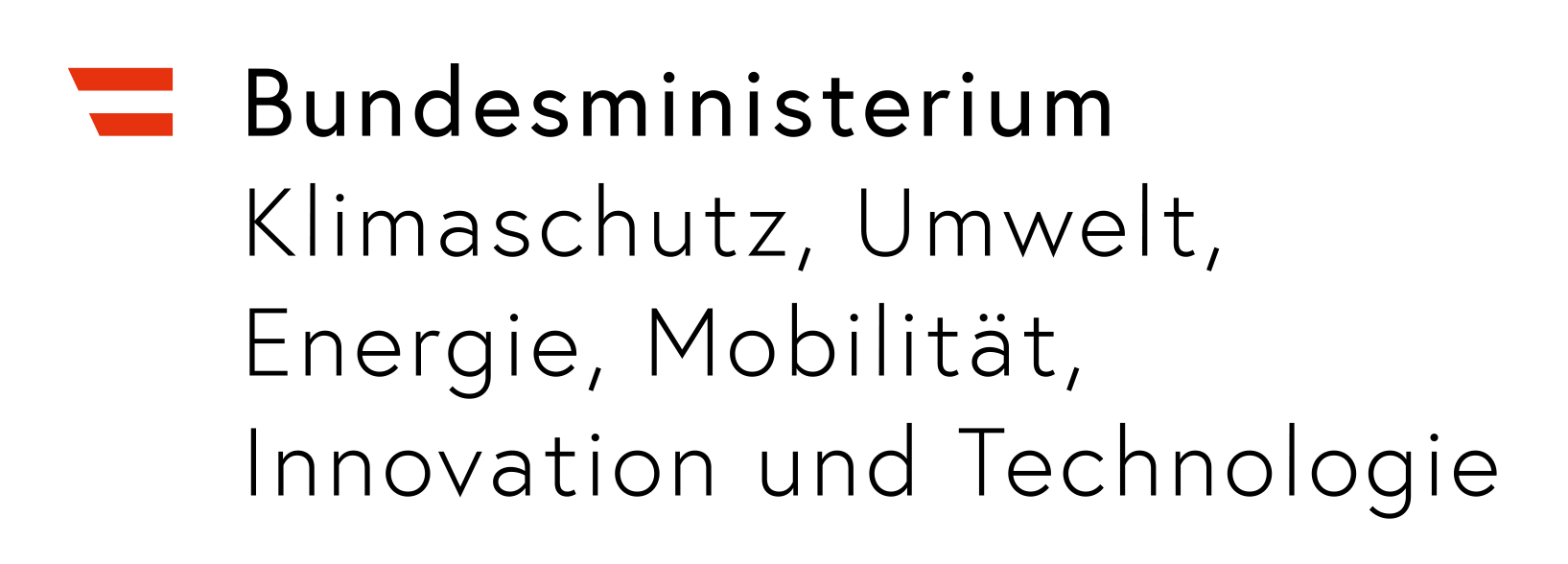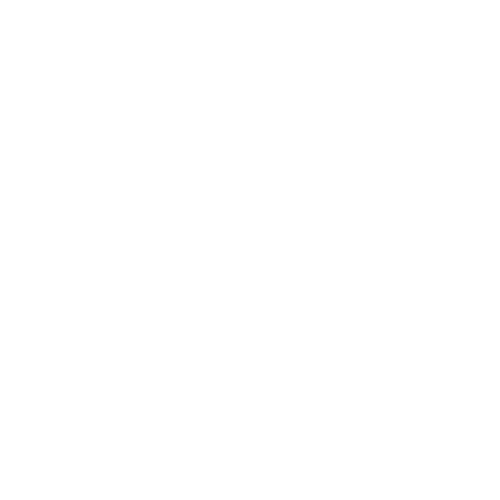Kategorie Innovation & Technologie - 24. Juni 2017
Mit dem Elektromotor auf der Siegerstraße
Paris/Wien – Sébastien Buemi liegt von Beginn an souverän an der Spitze. Die riskanten Überholmanöver innerhalb der Verfolgergruppe samt glimpflich verlaufender Kollisionen lassen den Schweizer und seinen blitzblauen Renault unberührt. Da und dort kommen härtere Fahrweisen auf. Die Beschleunigung aus den Kurven wird aggressiver. Polternde Bremsgeräusche, Schlittern in der Kurve. Auch wenn die Motoren kein lautstarkes Dröhnen von sich geben, fühlt man, dass die Fahrer die rohe Kraft zu bändigen haben.
Die Rennwagen, die sich an diesem Maiwochenende durch die engen Kurven rund um die Pariser Park- und Museumsanlagen des Hôtel national des Invalides drücken, sehen jenen Boliden ähnlich, die man aus der Formel 1 kennt. Aber nur äußerlich. Das verhaltene, hohe Kreischen, das sie bei der Beschleunigung von sich geben, lässt auf ganz andere innere Werte schließen. Ein Blick in die Boxenstraße zeigt, was sich anstelle des Benzintanks im hinteren Wagenteil befindet: eine Batterie. Willkommen beim Paris-Rennen der Formel E, der weltweiten Rennserie, die ausschließlich mit Elektroautos bestritten wird.
Die Batterien, die in den Formel-E-Autos verbaut sind, sind alle ident. Die Idee ist, ihren Gebrauch zu optimieren und möglichst viel Energie auf die Straße zu bringen. Spätestens beim Anblick der Trockeneisbehälter, die in den Boxen für die Kühlung der Batterien bereitstehen, wird klar, dass sie auch anders verwendet werden als in den Elektroautos für Otto Normalverbraucher.
„Die Batterien hier sind so konfiguriert, dass sie möglichst viel Leistung abgeben können. In Straßenautos sind sie dagegen auf einen langen Lebenszyklus abgestimmt“, sagt Nicolas Schottey, der bei Renault für die Batterieentwicklung zuständig ist, am Rande des Rennens, das am 20. Mai durch Paris führte. Renaults Elektroauto Zoe soll etwa beim Batteriemanagementsystem vom Formel-E-Ansatz profitieren. „Die Erfahrung hilft uns etwa beim Umgang mit extremen Konditionen und hohen Temperaturen“, betont Gilles Normand, der für die Elektromobilitätssparte bei Renault zuständig ist.
Rasante Entwicklung
Die Formel E wurde geschaffen, um die Elektromobilität zu den Menschen in die Städte zu bringen. In ihrer dritten Saison macht sie bereits in 14 Städten von New York über Berlin bis Hongkong Station. Ihr rascher Erfolg lässt darauf schließen, wie schnell die neue Technologie von nun an auf die Straße gelangen wird. Bei Renault, dessen Formel-E-Team von Formel-1-Legende Alain Prost mitbegründet wurde, hört man, dass die Entwicklung viel rasanter vonstattengeht, als man noch vor wenigen Jahren dachte. Die Industrie lässt bereits im Dreijahrestakt neue, immer leistungsfähigere Batteriegenerationen vom Stapel.
Doch welche Verbesserungsmöglichkeiten stehen den Batteriedesignern überhaupt noch zur Verfügung? Welche Leistungssteigerungen sind absehbar? Atanaska Trifonova leitet die Batterieentwicklung am AIT (Austrian Institute of Technology). Dort ist man stolz, den gesamten Entwicklungsprozess von der Materialoptimierung bis zum Batteriedesign und Systemtest abzudecken.
Trifonova sieht für die im Moment vorherrschenden Lithium-Ionen-Zellen noch vielfältige Optimierungsmöglichkeiten. Bei diesen Batterietypen fließen beim Be- und Entladen Lithiumionen in einer Elektrolytflüssigkeit zwischen Elektroden aus Kohlenstoff- und Metalloxidverbindungen hin und her. Sie zeichnen sich durch vergleichsweise hohe Energiedichte bei hoher Stabilität aus.
„Am wichtigsten ist die Erhöhung der Leistung und Kompatibilität der Materialien. Neue Verbindungen und Architekturen, die durch die Verwendung von Nanotechnologien erzielt werden, können Elektroden, Elektrolyt und Prozesse noch effizienter machen, Ionenfluss und -speicherung verbessern und beispielsweise unerwünschte Nebenreaktion in der Batteriechemie ausmerzen“, erklärt die Wissenschafterin. „Im Moment ist auf Zellebene eine Kapazität von 240 Wattstunden pro Kilogramm State of the Art. Bis zum Jahr 2020 soll dieser Wert laut EU-Zielvorgabe 300 erreichen.“ Das bedeutet, dass mit einer Zelle von einem Kilogramm ein Gerät mit 300 Watt Leistung eine Stunde lang betrieben werden kann.
Neben der Materialentwicklung und der industrienahen Optimierung kümmern sich die AIT-Forscher auch um Tests, Validierung und die Sicherstellung der Lebensdauer. Gemeinsam mit dem Grazer Forschungsinstitut Virtual Vehicle konnten die Experten vom AIT etwa einen Modellansatz entwickeln, der elektrochemische Prozesse mit einer Modellierung der Mikrogeometrie der Materialien in der Zelle kombiniert.
Langzeittests
Auch im Projekt Emprove, unterstützt vom österreichischen Klima- und Energiefonds des Umwelt- sowie des Verkehrsministeriums, kümmert sich Trifonovas Team um die Langzeitprüfung von Modulen. „Wir testen nun seit Monaten Batterien, die im Rahmen des Projekts entwickelt wurden, ohne die Abbruchkriterien zu erreichen. Das System ist sehr vielversprechend“, sagt die Batterieexpertin.
Bei der Integrierung von Batterien in ein Fahrzeugsystem stellt sich immer die Frage der thermischen Konditionierung. Das heißt: Wie halte ich die Zellen in einem Temperaturbereich, der weder zu warm noch zu kalt ist, um Leistung und Lebensdauer zu maximieren. Als Energiequelle für die Temperierung steht nur die Batterie selbst zur Verfügung. Im Rahmen des Projekts „Tes4seT“, an dem neben dem AIT und der TU Graz etwa das Institut AEE Intec vom Forschungsnetzwerk Austrian Cooperative Research (ARC) beteiligt ist, soll ein sogenannter Sorptionsspeicher entwickelt werden, der beispielsweise in Hybridfahrzeugen Abwärme im Fahrzeugbetrieb aufnimmt, um sie in der kühlen Nacht wieder abzugeben. Wärme und Kälte können simultan gespeichert und je nach Bedarf an die Batterie übertragen werden.
Noch ist im Bereich der Lithium-Ionen-Akkus einiger Spielraum zur Verbesserung vorhanden. Stefan Freunberger, der am Institut für Chemische Technologie von Materialien der TU Graz an den Grundlagen künftiger chemischer Energiespeichersysteme arbeitet, verortet für sie eine physikalische Obergrenze bei 350 Wattstunden pro Kilo.
„Im Fahrzeugbereich wird aber nie die maximal mögliche Energiedichte ausgeschöpft. Ein Teil wird zugunsten der Sicherheit und einer langen Lebensdauer geopfert“, stellt der Batterieforscher klar. Freunberger, der auch vom europäischen Forschungsrat ERC gefördert wird, ist vor kurzem zum Mitglied der Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) gekürt worden. Was passiert, wenn man es übertreibt bei der Ausreizung der Möglichkeiten, sieht man an den Fällen explodierender Handyakkus. Bei jeder Entwicklung muss ein passender Kompromiss gefunden werden, sind sich Experten einig.
Bei Lithium-Ionen-Systemen wird an den Elektroden auf volumenstabile, kristalline Substanzen zurückgegriffen, in deren feinste Poren die Lithium-Teilchen eingelagert werden. „Dieses Prinzip ist schon sehr ausgereift. Diese Materialien kann man nicht mehr sehr viel effizienter machen, ohne die stabile Struktur aufzugeben“, sagt Freunberger.
Einen Ausweg aus dem Dilemma bieten sogenannte Konversionsmaterialien. Sie weisen keine stabilen Strukturen mehr auf, sondern „blähen“ sich mit der Einlagerung der geladenen Teilchen auf und verändern ihr Volumen. „Der Vorteil ist, dass man viel mehr Energie speichern kann, der Nachteil, dass es viel schwieriger ist, Strukturen mit veränderlichem Volumen in eine Energiezelle zu verbauen“, sagt Stefan Freunberger.
Evolution der Batterie
Eine ganze Bandbreite an Konversionsmaterialien mit Potenzial für künftige Energiesysteme steht zur Verfügung. Forschungsteams weltweit arbeiten an entsprechenden Konzepten. Freunberger konnte mit seinem Team im Fachjournal Nature Energy kürzlich einen Beitrag über Konversionszellen auf Sauerstoffbasis leisten, die jedoch das Problem haben, viel zu rasch Alterungsprozesse zu entwickeln. Die Ursache der Alterung konnten die Grazer Wissenschafter näher bestimmen, indem sie eine erstaunliche Parallele zur biologischen Zellatmung fanden: Da wie dort sind sogenannte Singulett-Sauerstoff-Moleküle wesentlich an Alterungsprozessen beteiligt. In der Natur gibt es ein Enzym, das diesem Vorgang entgegenwirkt. Die Forscher schlugen nun Moleküle vor, die diese Aufgabe auch in Batterien übernehmen könnten.
Ein Wechsel zu Konversionsmaterialien wäre unbestritten ein großer Sprung in der Evolution der Batteriesysteme. Neben dem erhöhten Speichervermögen bringen sie eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich: Sie sind leichter verfügbar, weniger energieintensiv in der Herstellung, weniger giftig und einfacher zu recyceln.
Übertriebene Hoffnungen
Doch in der Darstellung ihres Speicherpotenzials würde auch viel Schindluder getrieben, warnt Freunberger: „Konversionsmaterialien können zwar bis zu zehnmal mehr Lithium-Ionen pro Gewichtseinheit einlagern als Materialien jetziger Lithium-Ionen-Batterien. Das heißt aber nicht, dass das Auto der Zukunft auch die zehnfache Reichweite erlangt.“ Der Haken dabei ist, dass nur ein kleiner Teil des Elektrodenvolumens tatsächlich als aktives Einlagerungsmaterial dient. In einem Kommentar in der Juni-Ausgabe von Nature Energy führt der Grundlagenforscher aus, dass ein optimiertes System etwa das Zwei- bis Dreifache des Speichervermögens derzeitiger Lithium-Ionen-Zellen erreichen kann – nicht mehr. „Viele Publikationen schüren Hoffnungen, ohne die limitierenden Faktoren anzugeben“, kritisiert Freunberger.
Wären die Batterien der Formel-E-Autos, die durch die Pariser Innenstadt kurven, bereits mit Konversionsmaterialien ausgestattet, würden sie jedenfalls bestimmt länger durchhalten. Laut Batterieentwickler Nicolas Schottey von Renault werden die Post-Lithium-Technologien frühestens in zehn Jahren die Praxis erreichen. Zurzeit biegen die Formel-E-Piloten zur Halbzeit noch in die Boxenstraße ein. Sie wechseln in Autos mit vollaufgeladenen Batterien, um das gesamte einstündige Rennen bestreiten zu können. Der Begeisterung der Menschen auf den vollen Tribünen tut das keinen Abbruch. Und Buemi hätte wohl mit jeder Batterietechnologie gewonnen. (Alois Pumhösel, 24.6.2017)
Hinweis: Die Reise nach Paris erfolgte auf Einladung von Renault.
Nature Energy-Links