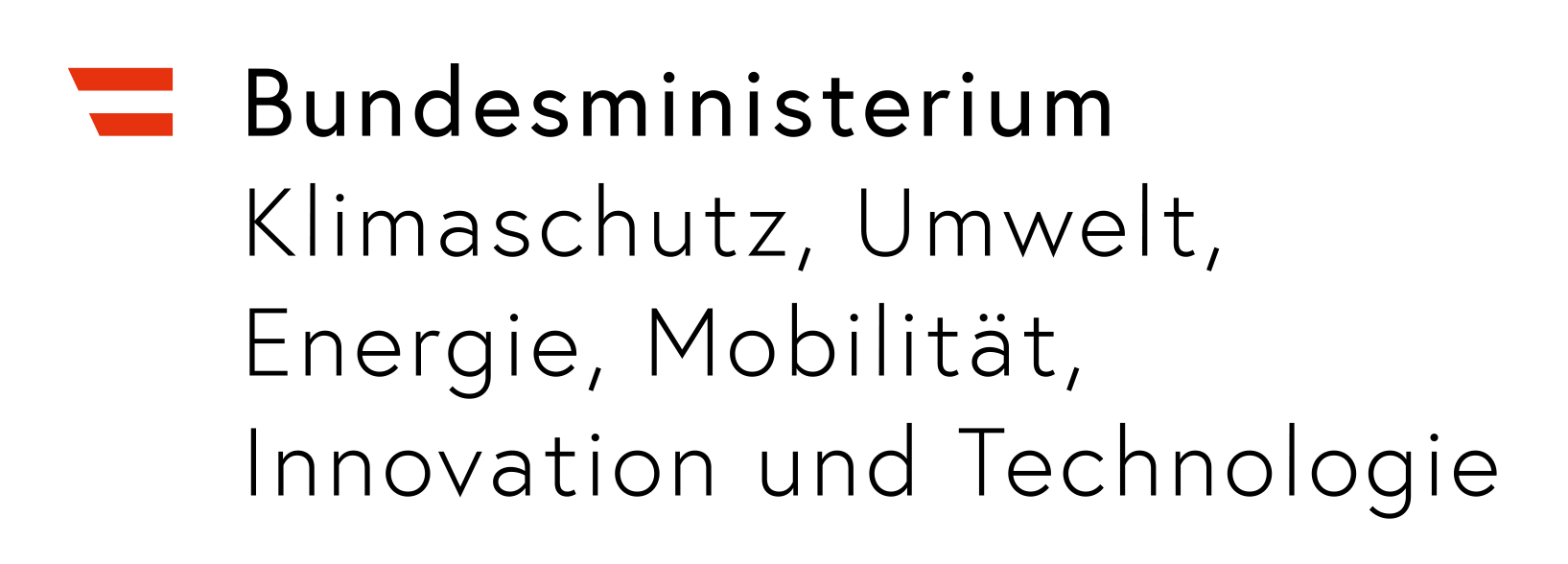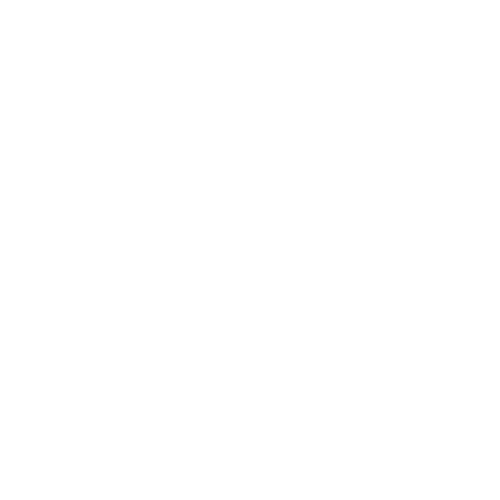Kategorie Innovation & Technologie - 23. August 2016
Neues, neu gedacht?
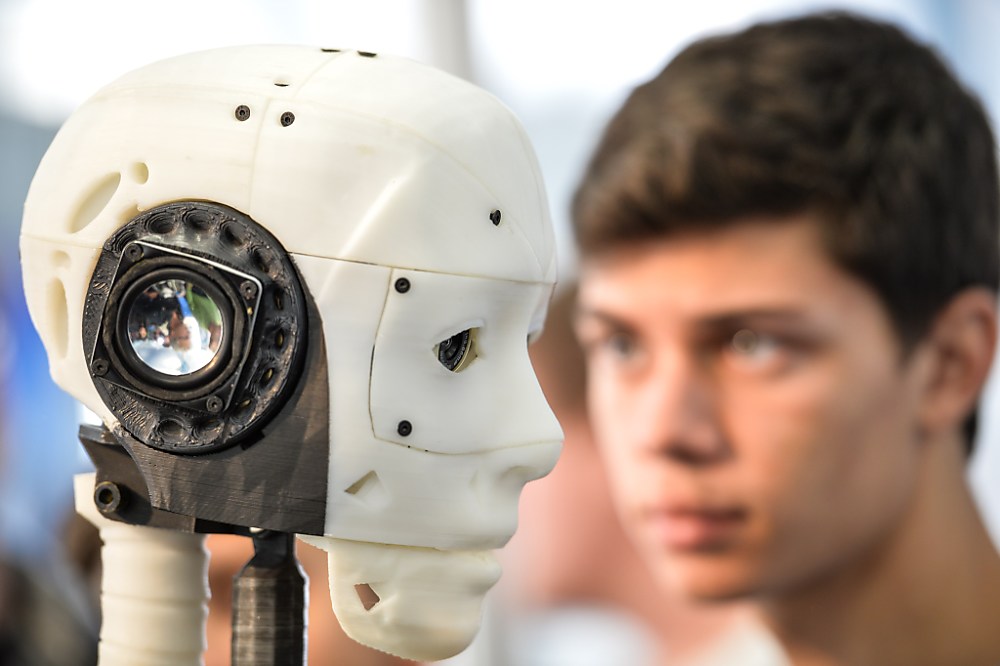
APA/APA (AFP)
Die Diagnose scheint klar: Für das Ersinnen, Entwickeln und Ausrollen von Innovationen gibt es bessere Böden als die heimischen. Innovationsanzeiger und einschlägige Studien sehen Österreich regelmäßig vorne dabei, aber eben nicht ganz oben. Könnten neue Zugänge wie „Open Innovation“, „Making“, „frugale Innovation“ oder ein forsches Anschieben des Wissenstransfers dieses Feld durchmischen? Erfährt Innovationskultur gerade einen größeren Umbau? APA-Science hat sich anlässlich der Alpbacher Hochschul- und Technologiegespräche ein paar einschlägige Trends näher angesehen.
Wirklich „Neues“ entsteht eher in großen Forschungsgruppen, die in Unternehmen oder anderen Einrichtungen in Hightech-Grenzbereichen tüfteln, und es dann auch noch schaffen, mit Hilfe eines Großkonzerns oder anderer potenter Partner, ihre hochtrabenden Entdeckungen auf den Boden des Marktes zu bekommen. Die Zeit der genialen Erfinder, Forscher oder Innovatoren, die monatelang in der Werkstatt oder im Labor werken und mit scharfem Blick eine Marktlücke ausmachen, die niemand vorher gesehen hat, ist eher vorbei. Das ist ein Befund, der immer wieder in der Diskussion auftaucht.
Zauberwort „Demokratisierung“
Allerdings, ganz so klischeehaft dürfte es in der Welt der Innovation nun doch nicht zugehen – oder zumindest nicht mehr lange. Zum vermeintlichen Königsweg der abgeschlossenen Expertengruppen, die immer mehr Hochtechnologie in jeden Winkel von Produkten und Dienstleistungen stopfen, haben sich in den vergangenen Jahren Alternativmodelle gesellt, die unter dem Stichwort „Demokratisierung“ zusammengefasst werden können.
Einer dieser Trends scheint sogar das Comeback des archetypischen „Erfinders“ mit sich zu bringen: Hinter „Making“ oder der „Maker-Kultur“ verbirgt sich eine Strömung, die auch als eine Art Revival des guten, alten „Bastelns“ angesehen werden könnte. Gesetzt wird jedoch nun auf das Do-it-yourself-Verfahren mit modernen Werkzeugen und Methoden, wie 3D-Drucker, CNC-Fräsen, Laserschneider, Elektronik-Tüftlerei, Modellbau, Selfmade-Robotik oder Upcycling – das Neuerfinden und Aufwerten scheinbarer Abfallprodukte und „nutzloser“ Stoffe. Die Player dieses quasi neo-traditionellen Zugangs zur Innovationskultur sind quer über den Erdball verstreut – trotzdem haben sich globale Zentren gebildet.
Im „Hollywood“ der Maker
Wenig überraschend befindet sich einer dieser Hotspots in China. Mit der Szene im „Hollywood“ der Maker, im südchinesischen Shenzhen, setzt sich die österreichische Forscherin Silvia Lindtner, Assistenzprofessorin an der Universität Michigan in Detroit, auseinander (siehe „‚Making‘: Vom Garagenhobby zum politischen Hoffnungsträger“). Mit einem ethnografischen Ansatz erforscht sie diese Community seit einigen Jahren von innen heraus. Begonnen habe dieser Trend, als sich junge Computerfreaks auf kreative Weise über staatliche Reglementierung hinwegsetzten. Das mag zwar revolutionär klingen, hatte aber einen fast erschütternd pragmatischen Hintergrund: Die ersten chinesischen Maker wollten einfach das in ihrer Heimat zensurierte Online-Computerspiel „Word of Warcraft“ spielen und mussten es dazu ummodeln.
Mittlerweile ist die Szene in der 13-Millionen-Stadt einen weiten Weg in Richtung Professionalisierung gegangen und wurde zur Keimzelle für Start-ups und Unternehmertum, wie Lindtner, die auch in Alpbach spricht, gegenüber APA-Science erklärte. Ein wichtiger Gedanke, der die „Maker“ antreibt, sei die Kooperation und das Teilen von Ideen und Lösungen – kurzum „Open Source“. Abschottungstendenzen würden in der Community sehr kritisch betrachtet, das gilt auch für den Schutz geistigen Eigentums.
Große Erwartungen und Warnung vor „schöner Rhetorik“
Schnell wurde die Hobbybewegung über Garagen und Unis hinaus bekannt: „Um 2011/2012 haben nicht nur Unternehmen sondern auch Regierungen angefangen auf diese Entwicklungen aufmerksam zu werden“, so Lindtner. Konzerne wie Intel begannen Szene-Events wie die – seit April dieses Jahres auch in Österreich etablierte – „Maker Faire“ zu sponsern, und auch Staaten treten mittlerweile als Sponsoren in Erscheinung. Neben dem Potenzial für Innovationen und wirtschaftliches Wachstum hätten einige auch Möglichkeiten im Bildungsbereich erkannt.
„Die Regierung Obama sponsert Making seit 2012 und die chinesische Regierung schon seit 2011. Seit 2015 gibt es in China eine National Policy, die das Making als eine Art Entrepreneurship fördert“, sagte die Wissenschafterin, für die Making auch eine politische Dimension eröffnet. Der Gedanke, dass durch die Demokratisierung des kreativen Schaffens und der Produktion auch die Gesellschaft offener wird, sei zwar „reizvoll“, vieles davon aber lediglich „schöne Rhetorik“. Lindtner: „Man sieht kaum einen Arbeiter aus einer Fabrik in einem Maker Space und auch wenige Frauen. Es ist noch immer eine männliche, privilegierte Vision.“
Österreich wird zum „Open Innovation“-Testgebiet
Auf eine Art großes Feldexperiment dahin gehend, wie weit ein anderer Zugang zur Öffnung des Innovationssystems selbiges verbessern kann, lässt sich Österreich als erstes Land der Welt mit der angekündigten nationalen „Open Innovation“-(OI)Strategie ein. Im Grunde genommen geht es bei OI darum, breitere Bevölkerungsschichten auf allen System-Ebenen einzubeziehen. Wie das zwischen dem Neusiedler- und Bodensee in den kommenden Jahren bewerkstelligt werden soll, wurde – wie könnte es anders sein – in einem möglichst offenen Prozess mit Beteiligung vieler Akteure unter Federführung der Bundesregierung via die Plattform http://openinnovation.gv.at ausgearbeitet.
Auf den Schultern des Modewortes lastet mittlerweile Einiges: Soll die Einbindung von Außenstehenden doch dem Forschungs-, Technologie- und Innovationsbereich insgesamt auf die Sprünge helfen. Durch Zusammenarbeit mit interessierten Teilen der Gesellschaft – oder neudeutsch „Crowds“ – würden Firmen weniger am Markt vorbei entwickeln und wissenschaftliche Arbeit auch ein Stück gesellschaftlich relevanter werden – Stichwort „Citizen Science“. Im besten Fall bringe das Hereinholen von anderen Sichtweisen und von Wissen aus der Peripherie genau jene Impulse, die echte Innovationen auslösen, sagen OI-Befürworter.
Damit diese Einbindung gelingt, brauche es vor allem echten Willen, Silodenken aufzubrechen, sowie verständliche rechtliche Rahmenbedingungen für jede Phase der Zusammenarbeit und Kommunikation auf Augenhöhe zwischen allen Beteiligten. Initiativen, im Rahmen derer das bereits gelungen ist, gibt es jedenfalls schon. Einen Einblick in ein österreichisches OI-Vorzeigeprojekt gibt u.a. der Gastkommentar „Neues Ausprobieren!“ von Patrick Lehner, Projektmanager für Open Innovation in Science in der Ludwig Boltzmann Gesellschaft. Im Rahmen der Technologiegespräche arbeiten Studenten-Gruppen 24 Stunden lang durchgehend an echten Problemen, vor denen österreichische Unternehmen stehen. Organisiert wird der „Innovations-Marathon“ vom Verein TU Austria, einem Zusammenschluss von den Technischen Universitäten (TU) Wien und Graz sowie der Montanuni Leoben.
Darf’s ein bisschen weniger sein?
Lässt man Außenstehende oder Menschen aus Entwicklungsländern Brainstormen, Forschen und Analysieren, und hält für sie sogar einen Platz am Entwicklungstisch bereit, kann eine Innovation auch einmal weit schlanker ausfallen als sie eine durchschnittliche westliche Forscher-Gruppe konzipieren würde. Hinter dem Schlagwort „frugale Innovation“ versteckt sich eine weitere Spielart der Öffnung von Innovationsprozessen. Damit einher geht eine andere Denkschule – vor allem für die Etablierung neuer Produkte.
Die Innovationssysteme in Hochtechnologie-Ländern sind traditionell stark darauf ausgelegt, noch mehr Hochtechnologie zu ermöglichen. Den Adressaten von Produkten ist allerdings nicht immer daran gelegen, auf mehr und mehr Features auf einem Gerät zurückgreifen zu können, die sie vielleicht gar nicht brauchen.
Schwieriger Rücktritt von „Schneller, Höher, Weiter, Mehr“
Vor allem in sogenannten Entwicklungsländern brauche es allerdings nicht unbedingt den letzten Schrei der Technik, um Erfolg zu haben. Das bedeute wiederum eine gewisse Abkehr vom Prinzip des „Schneller, Höher, Weiter, Mehr“ und eine Stärkung der Zusammenarbeit mit Wissenschaftern und den oft sehr kreativen und flexiblen Entwicklern aus Ländern abseits der westlichen Welt, wie Experten betonen.
Dieser Gedanke habe sich vor allem im sehr stark vom Ingenieursdenken geprägten deutschsprachigen Raum noch kaum verfestigt, wie der Geschäftsführer des Rates für Forschung und Technologieentwicklung, Ludovit Garzik, bereits im Frühsommer bei einer Veranstaltung in Wien erklärte und nun auch in seinem aktuellen Gastkommentar ausführt. Dass in Österreich die Anwendungsorientierung mangelhaft ausgeprägt ist, hänge zum Teil auch damit zusammen. Nicht nur die klassischen Beispiele für dynamische Innovations-Regionen, wie das Silicon Valley in Kalifornien oder das „Start-up-Paradies“ Israel, sondern etwa auch Beispiele aus Afrika zeigen, dass man andernorts oftmals Denk- und Handlungsschneller bei der Umsetzung ist, so Garzik.
Eine Frage der Innovationskultur
Spätestens an diesem Punkt rückt die Frage nach unterschiedlichen Innovationskulturen und deren Wandel (siehe „Gibt es zukünftig eine andere Innovationskultur?“) in den Fokus. Diplomatisch ausgedrückt „Aufholbedarf“ für Österreich orten Experten in dem Zusammenhang immer wieder. So sieht etwa der aus Österreich stammende IT-Sicherheitschef bei Google, Gerhard Eschelbeck, „in den USA oft den Fokus am Ansatz ‚Time-to-market‘ mit anschließender iterativer Verbesserung. In Europa/Österreich hingegen liegt der Fokus oft auf der Perfektionierung der Idee und dann erst auf dem ‚Go-to-market'“, wie er im Interview mit APA-Science erklärte.
Mehr Aufmerksamkeit erfährt seit geraumer Zeit auch der Wissens- und Technologietransfer von Hochschulen in Richtung Wirtschaft – etwa durch Ausgründungen aus dem akademischen Umfeld, sogenannten Spin-offs. Während es hier in den USA bereits eine lange Tradition gibt, wächst in Österreich bisher allenfalls ein zartes Pflänzchen: 2015 verzeichneten alle heimischen Universitäten insgesamt lediglich 13 solche Gründungen.
Universitäres Gründen als Einstellungssache
Franz Franchetti, Forschungsprofessor an der Carnegie Mellon University (CMU) in Pittsburgh, Mitbegründer der Spin-off-Firma SpiralGen und Präsident der Vereinigung österreichischer Wissenschafter in Nordamerika „ASCINA“ (Austrian Scientists and Scholars in North America) glaubt im APA-Science-Gespräch nicht, dass es den Forschern in Österreich an Mut oder Risikobereitschaft bei der Umsetzung von Erkenntnissen am Markt fehlt. Noch mehr als in den USA stelle sich hier aber die Frage, ob es überhaupt eine Infrastruktur gibt, die einem bei so einem Vorhaben eine reale Chance lässt. „Du musst das Risiko eingehen können, ohne dass es dich zerstört“, so der ASCINA-Chef.
In den USA sei mehr oder weniger jedem klar, dass man vielleicht mehrere Start-ups gründen muss, bis eines funktioniert. In Österreich bestehe die große Gefahr gleich „gebrandmarkt“ zu sein, wenn eine Idee nicht funktioniert. Franchetti: „Wenn immer ich mit Leuten rede, kommt das oft fehlende Grundverständnis dafür zur Sprache, was es heißt, eine Firma zu starten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Österreicher diese Grundeinstellung wirklich haben.“
Mitterlehner: „Wird noch weitere Unterstützungen brauchen“
Seitens der heimischen Politik wird die oft attestierte Umsetzungsschwäche im Innovationssystem in jüngerer Vergangenheit verstärkt angesprochen. Auch im Vorfeld der Hochschul- und Technologiegespräche erklärte Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP), dass es für ihn in Österreich nicht an der Grundlagenforschung mangelt, sondern an der praktischen Umsetzung.
„In Österreich wird das scheel betrachtet, da haben wir noch Nachholbedarf im Vergleich mit amerikanischen oder britischen Unis, was Spin-offs und Ähnliches anbelangt“, so Mitterlehner. Die eingerichteten Wissenstransferzentren würden nicht ausreichen, um den Transfer zu forcieren, „da werden wir noch weitere Unterstützungen brauchen“. Mit aktuellen Initiativen, wie dem kürzlich auf den Weg gebrachten „Start-up“-Paket oder der OI-Strategie sollen Veränderungen angestoßen werden.
Von Nikolaus Täuber und Mario Wasserfaller/APA-Science
Service: Diese Meldung ist Teil eines umfangreichen Dossiers, das auf APA-Science unter http://science.apa.at/dossier/innovationskulturen erschienen ist.