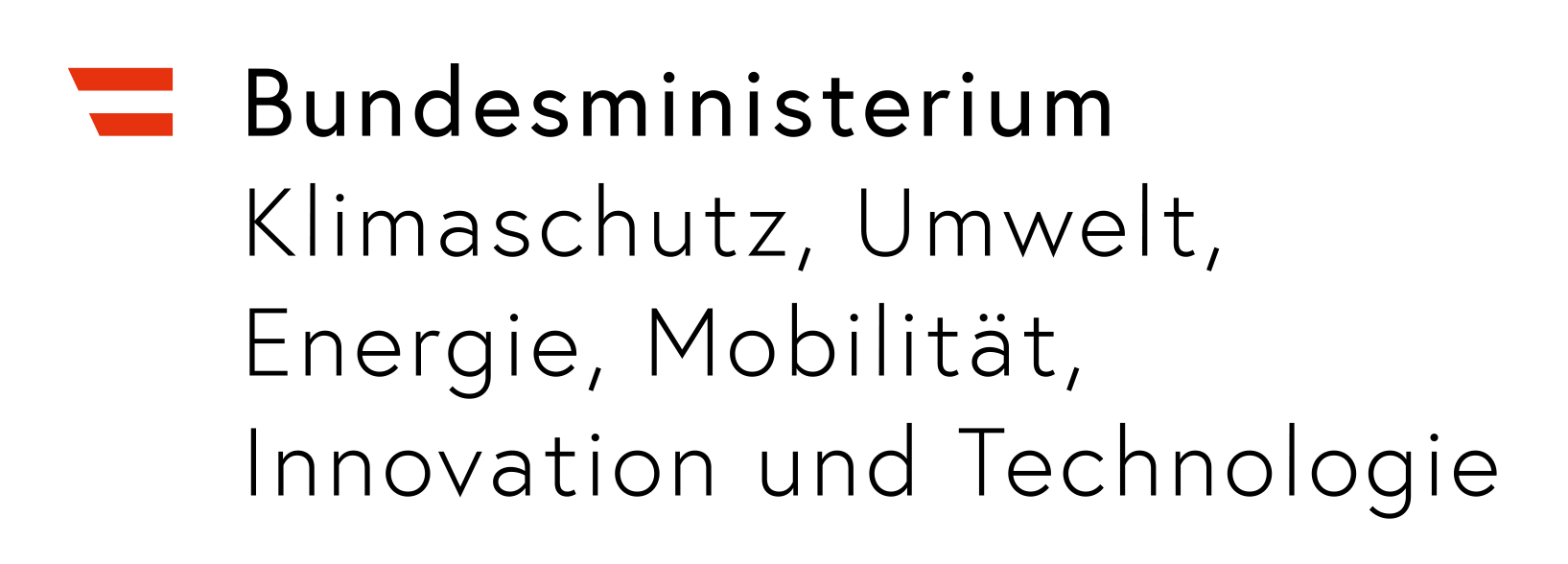Kategorie Innovation & Technologie - 4. Februar 2017
Frauen fahren anders, Männer auch
Vor allem Männer passen die Geschwindigkeit den Fahrverhältnissen nicht an, sie sind mitunter zu schnell unterwegs. Frauen wiederum verstoßen häufiger gegen Vorrangregeln und sind öfter in Unfälle involviert, die beim Abbiegen passieren – Unfallursachen, die allerdings auch bei Männern in höherem Alter zunehmen. Eine Analyse des häufigsten menschlichen Fehlverhaltens bei Verkehrsunfällen stand vor vier Jahren am Beginn des Forschungsprojekts „MueGen Driving“ an der TU Graz.
„90 Prozent der Verkehrsunfälle mit Personenschaden lassen sich auf menschliches Verhalten zurückführen“, erklärt Arno Eichberger vom Institut für Fahrzeugtechnik. Er leitet den Forschungsbereich Fahrerassistenz und Fahrdynamik. Dort arbeiten die Wissenschaftler an Weiterentwicklungen für das immer autonomer, also selbstständiger agierende Auto. Mit der Idee, die digitalen Assistenten nicht nur sicher zu gestalten, sondern deren Fahrstil auch möglichst gut an die Bedürfnisse der – irgendwann nur noch pausierenden – Passagiere auf dem Fahrersitz anzupassen.
Lernen wie ein Fahrschüler
Die Maschinen sollen lernen wie ein Mensch zu fahren, damit sich dieser wohlfühlt, wenn er einmal nur mehr mitfährt. Und dabei gibt es nicht nur Unterschiede zwischen den Geschlechtern. „Jeder lenkt sein Auto anders, der eine sportlicher, der andere konservativer“, sagt Eichberger. Nur: Woher soll die Maschine wissen, wie sie fahren soll?
„Menschen können sich in schwierigen Situationen zurechtfinden, einem Fahrerassistenzsystem muss man das erst beibringen“, schildert Ioana Koglbauer das Grundproblem. Die Psychologin vom Institut für Mechanik der TU Graz ist auf die Erforschung der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine spezialisiert. Sie vergleicht einen Roboter, der ein Auto lenkt, mit einem Fahrschüler: Beide lernten gutes und sicheres Fahren erst nach und nach.
Bei Tests der Systeme sei es wichtig, nicht nur Profis, sondern ganz normale Autofahrer einzuladen, die das System bewerten. Bereits 2013 baten die Forscher in der vom Technologieministerium geförderten Studie rund 20 Personen für sogenannte Real Driving Studies ans Steuer. Eskortiert von weiteren Forschungsfahrzeugen, die etwa die Geschwindigkeit messen, ging es südlich von Graz auf die Landstraße. Getestet wurde der Abstandsregeltempomat ACC. Wie fühlen sich die Lenker beispielsweise bei einem vorprogrammierten Sekundenabstand, wie bei 1,8 Sekunden Spielraum bis zur Kollision mit dem Auto davor?
Das Ergebnis entspricht ein Stück weit dem, was das Klischee vermuten lassen würde: Männer überschätzten den Abstand, Frauen unterschätzten ihn, sie fühlten sich früher unwohl. Beiden Geschlechtern war aber die längere Zeitlücke als Puffer lieber – und selbst diese schien den meisten Fahrern noch zu kurz. Tatsächlich bremsen die Systeme spät, weil sie meist auf trockenen Untergrund optimiert sind, zeigt Eichberger nun in einer neuen Publikation.
Ein Mini im Labor
Weil sich auf der Straße freilich keine wirklich gefährlichen Situationen nachstellen lassen, bauten die Forscher einen eigenen Fahrzeugsimulator. Sie stellten einen Mini Countryman in ihr Labor – allerdings ohne Motor und Getriebe. Dafür mit nachgestellten Motorvibrationen und Motorsound, komponiert von Akustikexperten des steirischen Motorenbauers AVL List. Die Projektpartner der österreichischen Forschungsgruppe der Fraunhofer Gesellschaft wiederum konstruierten mit rund um das Fahrzeug angebrachten Monitoren eine täuschend echte Umwelt.
Kameras erfassten die Blicke der 18 bis 86 Jahre alten Fahrer. Etwa hundert nahmen teil, sie lenkten den Mini auf einer trockenen oder schneebedeckten, rutschigen Landstraße durch die virtuelle Welt. Und wiederum gab es Abstandstests und auch Notbremsungen. Dabei zeigte sich, dass Frauen dem Bremsassistenten tendenziell weniger vertrauen. Mit zunehmendem Alter gab es hier aber kaum Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Und der Umgang mit der Technik? „Die Bedienbarkeit des Abstandstempomaten wurde von Frauen etwas schlechter eingeschätzt“, sagt Eichberger. (Von Alice Grancy, Die Presse)