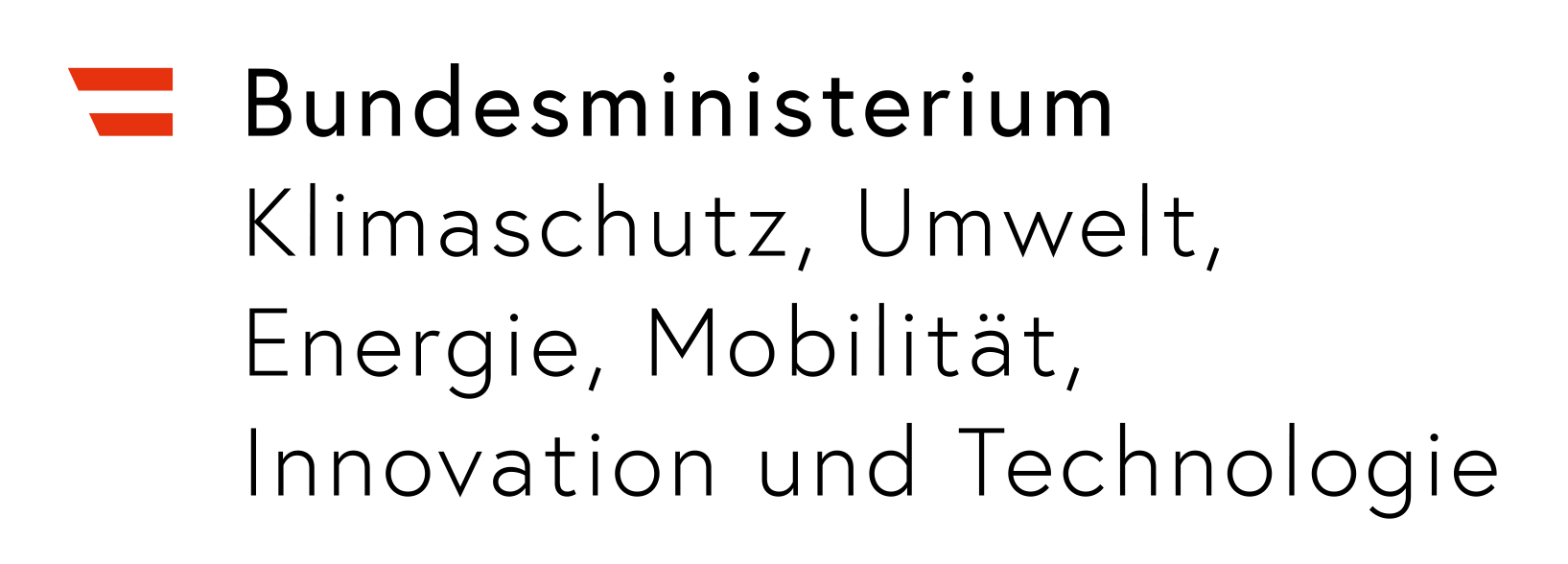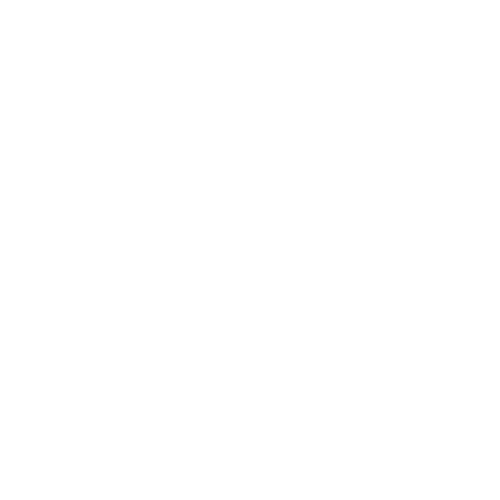Kategorie Innovation & Technologie - 15. Juni 2016
Gentrifizierung: Wohnen zwischen Hipster und Hausmeister
Wien – Samstags im Brunnenviertel in Wien-Ottakring: Türkische Standler neben Waldviertler Biofisch und exklusiver italienischer Feinkost. Dazwischen Käfigfußball und Integrationstheater. Und natürlich die Hipster, die wie immer die Lokale am Yppenplatz füllen. Rundherum Designläden, alternative Galerien. Unweit davon, am Gürtel, florierte bis vor kurzem die Dealerszene – die nach den jüngsten Polizeieinsätzen wohl in andere Gegenden weiterzieht.
Erst kürzlich ist das Viertel um den Brunnenmarkt – seit Jahren Vorzeigebeispiel für gelungene Integration – wegen eines Mordes wieder durch die Schlagzeilen gegangen. Wie ist es möglich, dass hier so verschiedene Welten quasi nahtlos aufeinanderprallen, ohne scheinbar etwas miteinander zu tun zu haben? „Hier zeigt sich Urbanität. Das ist Zusammenleben in der Stadt“, sagt die Stadtforscherin Yvonne Franz. Junge Hipster leben neben alteingesessenen Migranten, einstige Arbeiterbezirke wie Ottakring sind mittlerweile begehrte Wohngebiete.
Städtebild im Wandel
Yvonne Franz untersucht am Institut für Stadt- und Regionalforschung der Akademie der Wissenschaften in Wien, wie sich Städte und Stadtteile verändern. Dazu gehören Prozesse wie die Veränderung der Wohnbevölkerung – einerseits durch Aufwertung einzelner Viertel, Gentrifikation genannt, anderseits durch den Zuzug von Menschen unterschiedlicher Herkunft. Beides prägt das Bild vieler Städte maßgeblich und beeinflusst das soziale, politische und ökonomische Klima. Beides hat Franz in verschiedenen Projekten erforscht.
„Im Vergleich zu New York, London oder Paris gibt es in Wien keine Gentrifikation im Sinne einer direkten Verdrängung der angestammten Bevölkerung durch wohlhabendere, jüngere Bewohner, die teurere Mieten oder höhere Kaufpreise zahlen“, sagt Yvonne Franz. Auch eine indirekte Verdrängung, bei der sukzessive die Mieten steigen und sich das kulturelle Angebot und die Geschäftsstruktur verändern, bis die ursprüngliche Grätzelidentität verlorengeht, laufe in Wien nur langsam und eher schleichend ab, sagt die Stadtforscherin.
Gentrifizierung im Grätzel
In einem laufenden internationalen Forschungsprojekt hat sie zusammen mit Kollegen anhand des 15. Bezirks in Wien eruiert, ob hier Gentrifizierung stattfindet und wie sie wahrgenommen wird. Die Ergebnisse werden mit solchen aus entsprechenden Vierteln in Istanbul, Arnheim und Zürich verglichen. Der Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus hat seit dem Prostitutionsgesetz von 2011, mit dem der Straßenstrich verschwand, einen enormen Imagewandel durchgemacht. Was ehemals als Rotlichtviertel verrufen war, gilt nun als „hip“ und „charmant“, sagt Franz.
Über mehrere Monate hinweg nahmen die Wissenschafter in Parks, Cafés und bei Veranstaltungen am Grätzelleben teil, analysierten statistische Daten und machten Wohnungsbesichtigungen mit Maklern. Rund 150 Interviews mit Anwohnern, Unternehmern, Vertretern der öffentlichen Hand, mit Wohnbaugenossenschaften und Investoren wurden geführt. „Wien ist stolz auf das vergleichsweise leistbare Wohnen und argumentiert, dass zwei Drittel des Wohnungsmarktes gefördert sind und auch die Gründerzeithäuser unter das Mietrecht fallen“, sagt Franz. „Aber die Praxis der Leistbarkeit sieht oft anders aus.“
Es zeigte sich: Nicht jeder hält sich an das Mietrecht – was auch von jungen Neuzuzüglern in Kauf genommen werde, für die der 15. Bezirk noch immer leistbarer ist als ein Bezirk innerhalb des Gürtels. Weil neue Dachgeschoßausbauten meist als Eigentum angeboten werden, komme es zu „vertikaler Segregation“. Auch städtische Förderungen, etwa für Blocksanierungen, die eigentlich der angestammten Wohnbevölkerung zugutekommen sollen, würden oft nicht den gewünschten Effekt bringen. Deswegen ist eines der Projektziele, ein Frühwarnsystem für die Stadtverwaltung zu entwickeln, um Verdrängungsprozessen vorzubeugen.
Aber dennoch: Yvonne Franz will nicht die „Gentrifzierungskeule“ schwingen. „Eine Stadt ist nicht statisch. Nicht jede Veränderung ist schlecht.“ Wo früher von Boboisierung gesprochen wird, ist heute von Hipsterfication die Rede. Auch das sei nicht unbedingt ein Zeichen für Gentrifizierung. „Am Schwendermarkt in Rudolfsheim-Fünfhaus, der in den letzten Jahren saniert wurde, gibt es heute drei Hipster-Lokale mit gutem Kaffee und selbstgemachten Möbeln. Das führt dazu, dass sich dort wieder vermehrt Leute aus der Nachbarschaft treffen und sich wohlfühlen.“
Nachbarschaftsinitiativen
Es sind oft genau die hippen, noch relativ leistbaren Viertel, in denen sich Konflikte zwischen der ursprünglichen Bevölkerung und Neuzugezogenen entzünden. In einem anderen Projekt im Rahmen der Joint Programming Initiative Urban Europe, die auch vom österreichischen Infrastrukturministerium unterstützt wird, analysierten die Stadtforscher, wie das interethnische Zusammenleben in verschiedenen Wiener Grätzeln funktioniert und wie die nachbarschaftliche Koexistenz verbessert werden könnte. In Zusammenarbeit mit Forschern aus Amsterdam und Stockholm sollen Integrationsmaßnahmen und deren Erfolg in den verschiedenen Städten verglichen werden.
In Wien wurden das Hipviertel in Ottakring, Breitensee in Wien-Penzing und Gumpendorf, ein gürtelnaher Teil des sechsten Bezirks, unter die Lupe genommen. Städtisch gelenkte Integrationsmaßnahmen wie das „Willkommen Nachbar“-Programm in Gemeindebauten wurden analysiert ebenso wie Bottom-up-Initiativen von Baumscheibenbegrünung bis hin zur Onlineplattform „Frag nebenan“. Um sich ein Bild zu machen, gartelten die Forscher im Gemeinschaftsgarten, nahmen an Nähkursen im Nachbarschaftszentrum teil und führten mehr als 80 Interviews, um mehr über die Sichtweise von Bewohnern und Initiatoren zu erfahren.
Wichtige Berührungspunkte
Die ersten Ergebnisse zeigen: Dort, wo Migranten selbst aktiv sein können und ohne Sprach- oder institutionelle Hürden angesprochen werden, funktioniert das Zusammenleben am besten. Enorm wichtig für eine funktionierende Nachbarschaft sind öffentliche Räume als Orte der Begegnung und des Wohlfühlens – und solche sind häufig Mangelware.
„Das sozialromantische Ideal des allgegenwärtigen kulturellen Austauschs ist aber überschätzt“, sagt Franz. Oft hätten die Menschen gar keine Zeit, um sich in einer Initiative zu engagieren, und auch gar kein Bedürfnis an intensiveren Kontakten. „Wir sehen in Wien momentan noch ein weitgehend friedliches Nebeneinander der sozialen und ethnischen Gruppen, und das ist gut so“, resümiert Franz. „Im Vergleich dazu gibt es in Amsterdam und Stockholm viel mehr Konflikte – bis hin zu brennenden Vororten.“
Um mehr Berührungspunkte zu schaffen, sind oft die einfachsten Mittel die wirksamsten, wie die Stadtforscher herausfanden. „Wenn einen die Billa-Kassiererin oder ein Nachbar auf der Straße erkennt und man sich grüßt, hilft das ungemein, sich wohlzufühlen“, sagt Franz. Da kann jeder bei sich selbst anfangen – von der Oma bis zum Hipster. (Karin Krichmayr, Der Standard)