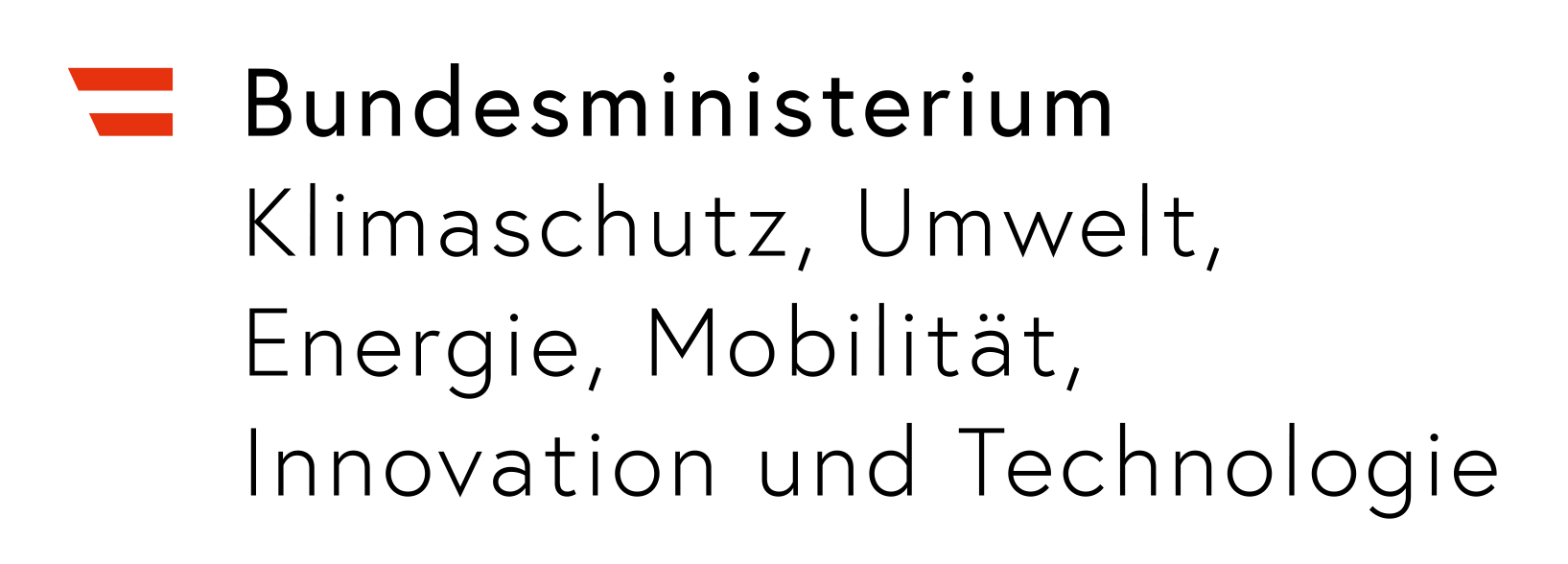Kategorie Innovation & Technologie - 17. September 2015
Innovationsökonomin: „Forschung für die Armen wird vernachlässigt“
STANDARD: Sie forschen zu Innovationen in Entwicklungsländern – wie unterscheiden die sich von Innovationen in reichen Ländern?
Shyama Ramani: Die Effizienz, mit der Wissenschaft zu Technologie transformiert wird, ist in den Entwicklungsländern viel niedriger als in den reichen Ländern – das zeigt sich in den Publikationsstatistiken und bei den Patentanmeldungen. Ein großes Problem ist, dass es einen klaren Technologiegap zwischen armen und reichen Ländern bei Innovationstechnologien gibt, etwa im Biotech-Sektor. Das führt dazu, dass die risikoreichen Aspekte von Innovationen von den reichen in arme Länder ausgelagert und auf dem Rücken armer Menschen ausgetragen werden. Westliche Pharmaunternehmen führen in großem Ausmaß Medikamententests mit der armen Bevölkerung in Indien durch. Gleichzeitig wird diese später aber nie Zugang zu den fertigen Produkten haben. Außerdem investieren Pharmaunternehmen vor allem in Forschung über Krankheiten, von denen der Westen betroffen ist. Die Forschung, die den Armen dienen würde, wird vernachlässigt.
STANDARD: Wie kommt es, dass Forschung nicht unabhängig von der Industrie agiert?
Ramani: Wissenschafter, die gegen den Mainstream forschen, haben Schwierigkeiten zu publizieren. Ein Beispiel: Ein Paper, in dem ich mich kritisch mit dem Agrarkonzern Monsanto auseinandersetzte, wurde neunmal zurückgewiesen, bis ich es publizieren konnte. Monsanto hat wie auch große Pharmakonzerne eine mächtige Lobby. Da ist es schwierig dagegenzuhalten. Unter Sozialwissenschaftern kommt hinzu, dass es zwar viele gibt, die theoretische Modelle aufstellen und Berechnungen machen, sie sprechen allerdings nicht mit den Menschen, um sie zu fragen, welchen Nutzen oder Schaden Technologie und Innovationen für sie haben.
STANDARD: Sie sprechen nicht nur mit den Menschen, sondern haben 2004 auch eine NGO gegründet, um armen Menschen in Indien zu helfen – wie kam es dazu?
Ramani: Wäre nichts passiert, wäre ich eine theoretische Ökonomin wie viele andere geblieben. Doch dann ereignete sich der asiatische Tsunami. Meine Familie war damals am Strand bei einer Hochzeit. Ich dachte daher, dass ich meine ganze Familie in nur wenigen Minuten verloren habe. Doch die Welle stoppte einen Kilometer vor der Hochzeitsgesellschaft. So hatte ich das Gefühl, dass ich etwas tun muss.
STANDARD: Sie hatten zuvor nur theoretisch zu Entwicklungsarbeit geforscht – wie sind Sie in der Praxis konkret vorgegangen?
Ramani: Zunächst machte ich mich auf die Suche nach einem Dorf, in dem es möglich ist, über einen längeren Zeitraum zu arbeiten. Dann habe ich meine Familie und Bekannte gebeten, mir für drei Jahre je zehn Euro zu geben. Das haben sehr viele gemacht, und so begann das Projekt. In dem Dorf stellte sich heraus, dass eines der wichtigsten Bedürfnisse Toiletten waren. Das Dorf war von Wald umgeben, doch der Tsunami hatte die Bäume mitgerissen, und so mussten die Frauen auf die Müllberge rund um das Dorf gehen. Am Abend wurden sie dort von Ratten gebissen, und Männer fingen an, Fotos von ihnen zu machen. Das Bedürfnis nach Toiletten war also dringend – aber ich hatte natürlich keine Ahnung, wie man Toiletten baut. In einer Lehrveranstaltung fanden meine Studierenden heraus, dass es ökologische Toiletten gibt – diese haben wir dann in dem Dorf gebaut.
STANDARD: Auch Jahre nach dem Toilettenbau haben Sie das Dorf weiterhin besucht, welche Veränderungen sind Ihnen aufgefallen?
Ramani: Viele NGOs und Firmen bauten ähnliche Toiletten, doch niemand überprüfte deren Qualität und den Umstand, ob sie überhaupt von den Menschen verwendet wurden. Zweieinhalb Jahre nach dem Bau der Toiletten fanden wir heraus, dass nur noch die Hälfte im Einsatz war – die Qualität war einfach nicht gut. Das brachte mich zum Nachdenken. Wir sind nun dabei, lokale Menschen einzusetzen, die sich vor Ort für die sanitäre Infrastruktur und das Müllmanagement verantwortlich fühlen.
STANDARD: Warum sind Toiletten für Sie auch weiterhin ein zentraler Ansatzpunkt geblieben?
Ramani: Die Krankheit, die in Indien die meisten Todesfälle verursacht, ist nicht Aids oder Krebs. Es ist Durchfall. Die Ursachen dafür sind verunreinigtes Wasser und mangelhafte Sanitärinfrastruktur. Es gibt zwar Wasserleitungen, aber sie werden durch Fäkalien kontaminiert. 50 Prozent der Inder haben keinen Zugang zu Toiletten, weltweit sind es 2,5 Milliarden Menschen.
STANDARD: Wie sehr hat sich Ihr persönliches Engagement auf Ihr akademisches Denken ausgewirkt?
Ramani: Sehr stark, doch die Beziehung zwischen Aktivismus und Denken war von Angst geprägt. Ich hatte Angst, hinausgeworfen zu werden, wenn ich mich nun sozial engagiere. Deswegen habe ich sehr viel gearbeitet, und meine Produktivität hat sich dadurch noch gesteigert. Dass ich plötzlich die Nützlichkeit der Theorie sehen konnte, hat mein Denken stark beeinflusst.
STANDARD: Worin liegen die Vorteile und die Herausforderungen, Wissenschaft und Aktivismus zu kombinieren?
Ramani: Universitäten sind öffentliche Einrichtungen, daher ist es sehr schwer, Professoren ohne weiteres hinauszuschmeißen. In der Theorie wird von allen akademischen Institutionen erwartet, dass die Wissenschafter einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten – sie sind ja hauptsächlich durch öffentliche Gelder finanziert. Doch in der Praxis wird das oft als Widerspruch gesehen – und auch gelebt. Es kann passieren, dass man als Professor nicht mehr unterstützt wird, wenn man sich sozial engagiert. Es gibt Tendenzen, zu glauben, dass alles, was keinen ökonomischen Nutzen hat, wertlos ist.
STANDARD: Sie sind indische Staatsbürgerin, haben aber seit dem Studium nicht mehr in Indien gelebt, doch viel über das Land gearbeitet. Was fasziniert Sie an Indien?
Ramani: Es ist das Land mit der größten demokratischen Gesellschaft, doch es ist auch ein Land mit großen Ungleichheiten. Mein Leben war nicht viel anders als jenes von Menschen im Westen, außer dass ich keine sexuelle Freiheit hatte – was ich aber nicht vermisst habe. Doch es gibt einen großen Unterschied zwischen meiner Freiheit und der Freiheit, die ein Dorfbewohner in Indien hat. Die Gesellschaft ist sehr polarisiert.
STANDARD: Welche Rolle spielen Forschung und Entwicklung in dieser polarisierten Gesellschaft?
Ramani: In den letzten 60 Jahren haben Forschung und Technologie in Indien definitiv zu Wirtschaftswachstum geführt, allerdings nicht zu einer inklusiven Entwicklung. Wirtschaftswachstum und ökonomische Entwicklung sind nicht dasselbe. Ökonomische Entwicklung heißt, dass jeder die Chance auf Entwicklung hat. In Indien haben wir die größte Armutslast weltweit, und diese ist sehr ungleich verteilt: Es gibt eine große Bevölkerung und viele verschiedene Ethnien. Einige davon sind nie in der Mittelschicht angekommen und leiden besonders unter Armut. Es gibt so viele nebeneinander existierende Lebensweisen in Indien – das macht das Land so faszinierend, aber auch so herausfordernd. (von Tanja Traxler, Der Standard)
Shyama Ramani (55) ist Ökonomieprofessorin an der United Nations University Maastricht in den Niederlanden. Die gebürtige Inderin hat über spieltheoretische Ansätze in den Wirtschaftswissenschaften an der Cornell University in Ithaca, New York, promoviert. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen die Rolle von Technologie und Innovation in Entwicklungsprozessen. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Letzte Woche war sie im Rahmen des vom Verkehrsministeriums finanzierten Forschungsschwerpunktes „Wissenschafts- und Technologieaußenpolitik“ am Österreichischen Institut für Internationale Politik in Wien.