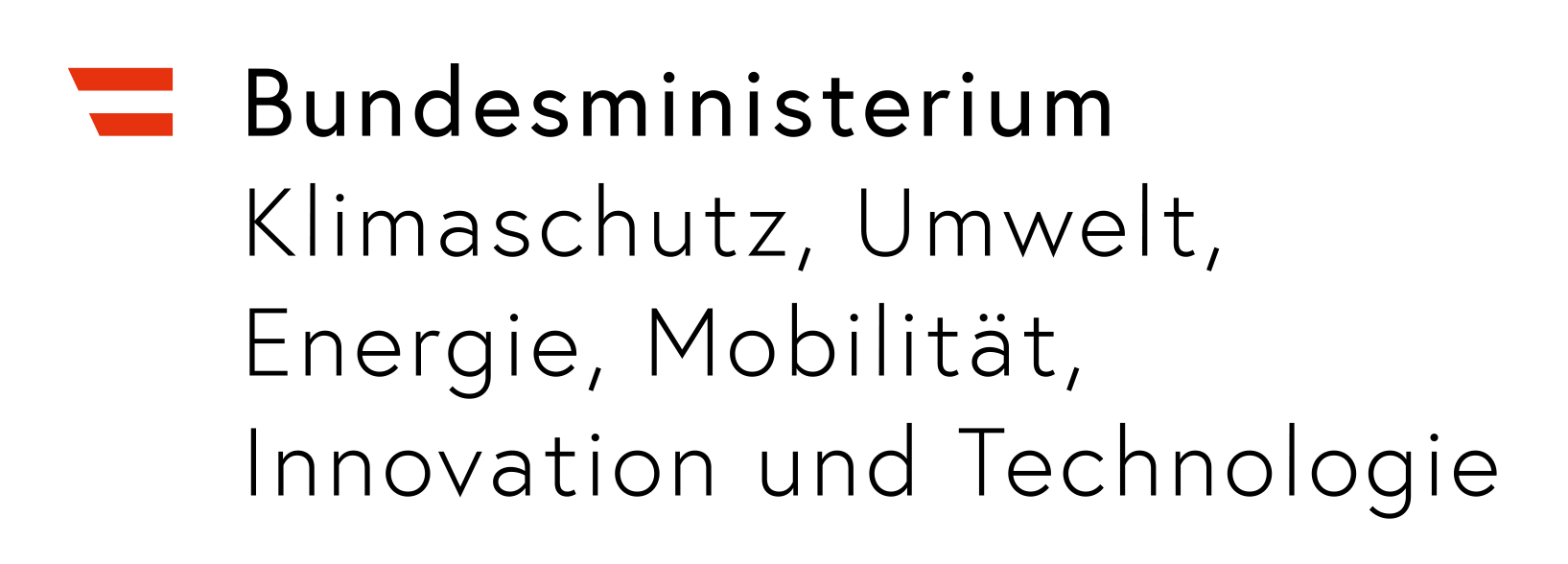Kategorie Innovation & Technologie - 23. Juni 2016
Ökonom Philippe Aghion sieht Innovation als Motor für soziale Mobilität

APA/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD
Einerseits führen Innovationen zwar dazu, dass Einkommen von Top-Verdienern überproportional steigen, andererseits erhöhen sich in einem innovativen Umfeld auch die Chancen, auf sozialen Aufstieg. Das erklärte der französische Ökonom Philippe Aghion bei einer Veranstaltung des Infrastrukturministeriums in Wien. Minister Jörg Leichtfried (SPÖ) betonte auch die Schattenseiten von Innovation und forderte eine breitere Diskussion darüber.
Der Befund, dass sich die Top-Einkommen seit den 1980er Jahren quasi vom Rest der arbeitenden Bevölkerung entkoppelt haben und in den Himmel gewachsen sind, zeigt, dass die Verteilungsgerechtigkeit auch in bisher relativ egalitären Gesellschaften immer weniger gegeben ist. Entsprechend weit rückt nicht nur die Frage in den Fokus, wie wirtschaftliches Wachstum unter diesen Umständen gefördert werden soll, sondern auch die danach, wie breitere Bevölkerungsschichten davon profitieren können. Als Antwort auf ersteres steht das Wörtchen „Innovation“ bereits seit längerer Zeit hoch im Kurs. Der Wirtschaftswissenschafter Aghion setzt auch bei Letzterem auf die Kraft der Erneuerung durch Forschung und Entwicklung.
Innovation „als ‚gute‘ Quelle für Top-Einkommen“
Seit den 1980ern stiegen nicht nur die Top-Einkommen, man beobachtete auch einen starken Anstieg an Innovation, wie Aghion bei der Diskussionsveranstaltung mit dem Thema „Gesellschaftliche Dimension der Innovation“ ausführte. „Innovation ist also auch eine Quelle für Ungleichheit“, bei genauerem Hinsehen entpuppte sich Innovation aber „als ‚gute‘ Quelle für Top-Einkommen“, sagte der Professor für Institutionen-, Innovations- und Wachstumsökonomie am College de France in Paris.
Das lasse sich am Beispiel zweier Multimilliardäre darstellen: Während sich das Vermögen des 2011 verstorbenen Apple-Chefs Steve Jobs auf tatsächlichen Neuentwicklungen begründe, fuße jenes des mexikanischen Milliardärs Carlos Slim darauf, dass er aus der Privatisierung der Telekombranche in Mexiko quasi als Monopolist hervorgegangen ist. Durch seine Innovationen habe zwar auch Jobs immer wieder kurzzeitig Monopole und Raum für hohe Gewinne geschaffen, diese seien von einem dynamischen Umfeld allerdings relativ schnell wieder geschlossen worden. Es zeige sich aber, dass er damit Wettbewerb, Wachstum und den Arbeitsmarkt anregt und gleichzeitig Freiräume für sozialen Aufstieg geschaffen habe, argumentierte der Ökonom.
System „Slim“ als Innovationsbremse
Anders die Situation rund um Slim: Seine Gewinne kämen nicht aus Innovation, sondern durch die marktbeherrschende Stellung zustande. Das stoße kaum echtes Wachstum an. Zudem tendieren Monopolisten dazu, ihre Stellung durch Lobbying zu festigen, nicht jedoch durch Innovationen, erklärte Aghion. Das sei gleichfalls schlecht für das Wachstum und führe dazu, dass sich im System nichts ändert, Spitzenverdiener weiter unter sich bleiben und soziale Mobilität sowie Verteilungsgerechtigkeit gehemmt werden.
Das Fazit des Ökonomen: Wenn die Politik an mehr sozialer Mobilität und in der Folge Verteilungsgerechtigkeit interessiert ist, dann müsste sie einen Steve Jobs und einen Carlos Slim anders behandeln – indem diese etwa verschieden besteuert werden. Es gelte zu Verhindern, dass Top-Verdiener ihre Ressourcen dafür einsetzen, um Barrieren zu errichten und damit Innovation blockieren. Für Aghion ist das Gebot der Stunde daher eine aktive, flexible und „smarte“ Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik. Vor dem Hintergrund, dass flexiblere Arbeitsmärkte in der Regel zu mehr sozialer Mobilität führen, müssten etwa auch linke Politiker dazu tendieren, zu sagen: „Wir nehmen so eine Reform.“
Leichtfried fordert mehr Augenmerk auf Innovationsverlierer
Die sozialen Auswirkungen von Innovation rückte auch Infrastrukturminister Leichtfried ins Zentrum seiner Ausführungen. In der Obersteiermark habe sich etwa nach dem Niedergang der verstaatlichten Industrie die Erkenntnis durchgesetzt, dass man nicht wie bisher weitermachen könne. Durch Forschung und Innovation sei es gelungen, den einstigen „Stahlfriedhof“ zu einem „metallurgischen Zentrum Europas“ zu machen. In der Region zeige sich aber auch sehr eindrücklich, wie stark Innovation die Gesellschaft verändere.
In den neuen Fabriken brauche es in erster Linie Facharbeiter, Ingenieure und Absolventen von technischen Studien. „Was ist aber mit denen, die diese Qualifikationen nicht haben?“, fragte der Minister. Dass diese Leute Gefahr laufen, noch umfassender durch Computer und Roboter ersetzt werden, „wird noch viel zu wenig diskutiert. Es wird nämlich immer auch Leute geben, die mit der Innovation nicht mitkommen.“