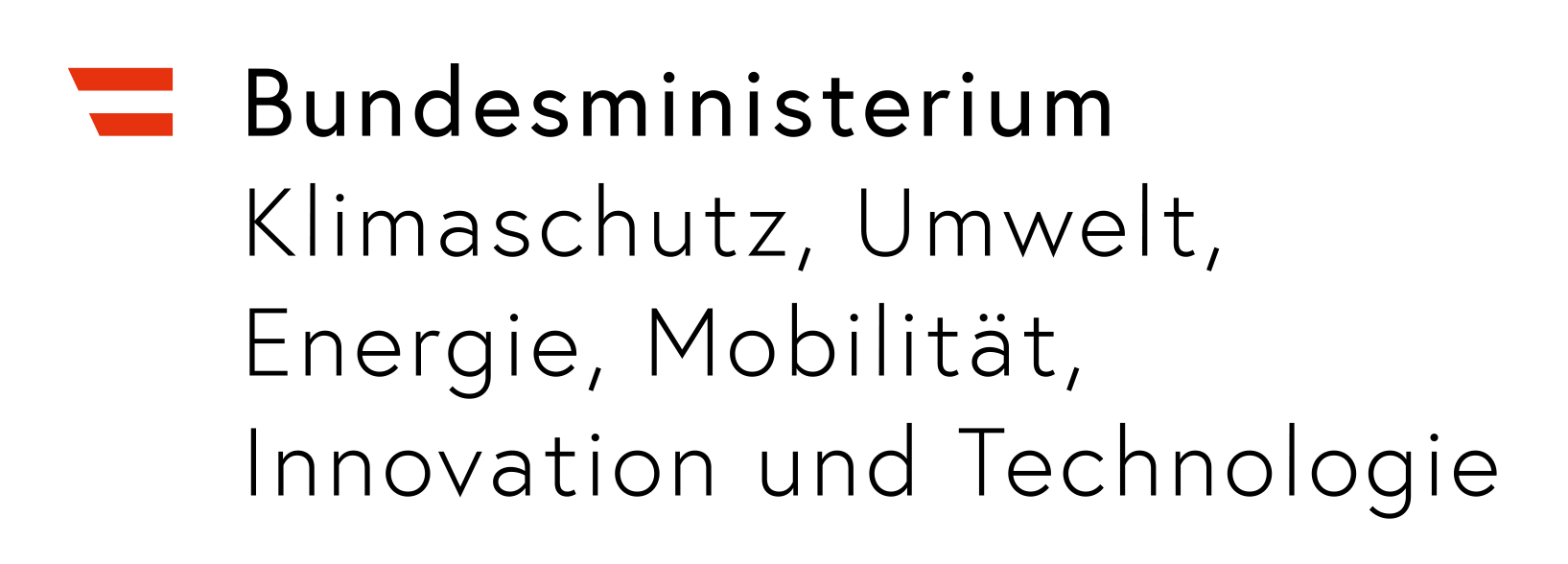Kategorie Innovation & Technologie - 14. Dezember 2017
Zu 100 Prozent aus Hanf gebaut
Von Alice Grancy
Alles, was wir heute im täglichen Leben in Form von Kunststoff an kleinen Helfern haben – Kaffeebecher, Kugelschreiber oder Handys – soll künftig aus natürlichen, sogenannten biobasierten Kunststoffen bestehen. Das ist die Vision von Ralf Schledjewski vom Department Kunststofftechnik der Montanuniversität Leoben. Der Maschinenbauer befasst sich seit dem Studium mit Werkstoffen und damit, wie sie sich durch Kombination verbessern lassen: hinsichtlich Eigenschaften wie Härte und Gewicht, aber auch hinsichtlich der genutzten Rohstoffe. Denn da die Erdölreserven immer knapper werden, gewinnen Materialien aus der Natur zunehmend an Bedeutung.
„Das Ende der petrochemischen Basis ist absehbar“, sagt Schledjewski. Und auch wenn derzeit nur zwei bis drei Prozent des Rohöls für Kunststoffe verwendet und der Rest verbrannt werde, gelte es, nach Alternativen Ausschau zu halten. Hanf oder Cannabis, so der wissenschaftliche Name, zählt zu den ältesten bekannten Nutz- und Zierpflanzen. Die robuste Faser der krautigen Pflanze wurde schon vor Christi Geburt für Kleidung genutzt. Im Mittelalter stellte man Bogensehnen daraus her, in der Schifffahrt trotzten Segeltücher und Seile aus Hanf großen Belastungen. Es lag also für die Forscher nahe, die Vorteile der schnell nachwachsenden Pflanze für ihre Zwecke zu nutzen.
Ein Windrad aus Cannabis
Sowohl die Fasern als auch das aus den Samen gewonnene Öl lassen sich für technische Zwecke einsetzen. Das Öl ist der Rohstoff für das Harz, in das Hanfstroh eingelegt wird. Doch zuvor werden die Fasern aufbereitet, zu einem Gewebe verarbeitet und möglichst in die Richtung angeordnet, aus der eine Kraft einwirkt. Das testete ein österreichweites Forscherkonsortium im Projekt „Green2Green“ für jeweils zwei Meter lange Rotorblätter einer kleinen Windkraftanlage. Mit Sommer 2017 sollten diese auf dem Hof eines Waldviertler Hanfproduzenten die Leistungsfähigkeit des neuen Materials zeigen. Die Bauteile sollten zu 100 Prozent aus Hanf sein: umweltfreundliche Windenergie, ganz aus biobasiertem Material – ein durch und durch grünes Konzept.
Doch das Material zeigte nicht die gewünschten Eigenschaften. Es stellte sich heraus, dass man für Katalysatoren, die die Reaktionen in Schwung bringen sollten, und zum Aushärten des Materials weiter Stoffe auf petrochemischer Basis brauchte. „60 Prozent der benötigten Kohlenstoffatome kommen bereits aus nachwachsenden Ressourcen, der Rest aus der Petrochemie“, erklärt der Forscher.
Natürliches kann giftig sein
In ersten Versuchen erwiesen sich einzelne Bestandteile überhaupt als gesundheitlich bedenklich. Dass natürlich automatisch auch gesund bedeute, sei ein weit verbreiteter Irrtum: „Die wirksamsten Gifte sind meist Naturprodukte“, sagt Schledjewski. Das Material müsse daher für die Produktion entsprechend aufbereitet werden. Daher werden die Forschungsarbeiten in einem weiteren, vom Technologieministerium in der Programmlinie „Produktion der Zukunft“ geförderten Projekt gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft weitergeführt.
In diesem wollen sich die Wissenschaftler in mehrfacher Sicht verbreitern: Erstens sollen immer mehr Bestandteile der biobasierten Faserverbundwerkstoffe auf nachwachsenden Rohstoffen aufbauen. Zweitens will man in den Entwicklungsarbeiten neben Hanf auch andere Nutzpflanzen, etwa Flachs oder Jute, testen. Und drittens wollen die Wissenschaftler neue Anwendungsbereiche erschließen, etwa Bagger oder Radlader für die Bauindustrie aus Naturstoffen herstellen. „Wir wollen sehen, was aus biobasierten Materialien alles machbar ist“, sagt Schledjeweski.
Dazu liefert die oberösterreichische Firma BTO-Epoxy die Rezepte für die Harze, das Kärntner Kompetenzzentrum Wood bearbeitet die Öle im Labor. „Unser Schwerpunkt an der Montanuniversität ist, Harze und Fasern in der Geometrie eines Bauteils so zu verbinden, dass am Schluss die Eigenschaften des Produkts passen“, sagt der Lehrstuhlleiter für die Verarbeitung von Verbundwerkstoffen.
Die Herausforderung sei, die neuen Hochtechnologien so einzusetzen, dass sie sich nicht mit anderen Interessen kannibalisieren. Die Frage dürfe nicht lauten: Nahrung oder Kunststoffbauteile, sagt Schledjewski. „Wir brauchen Lösungen, die sich sinnvoll ergänzen.“ Denkbar sei etwa, Teile der Pflanze für Verbundwerkstoffe und Teile als Lebensmittel zu nutzen. Immerhin konkurrenziert Hanf weniger mit dem Speiseplan als Raps-, Lein- oder Sonnenblumenöl. Und wenn von der Pflanze doch etwas überbleibt, verrottet es.