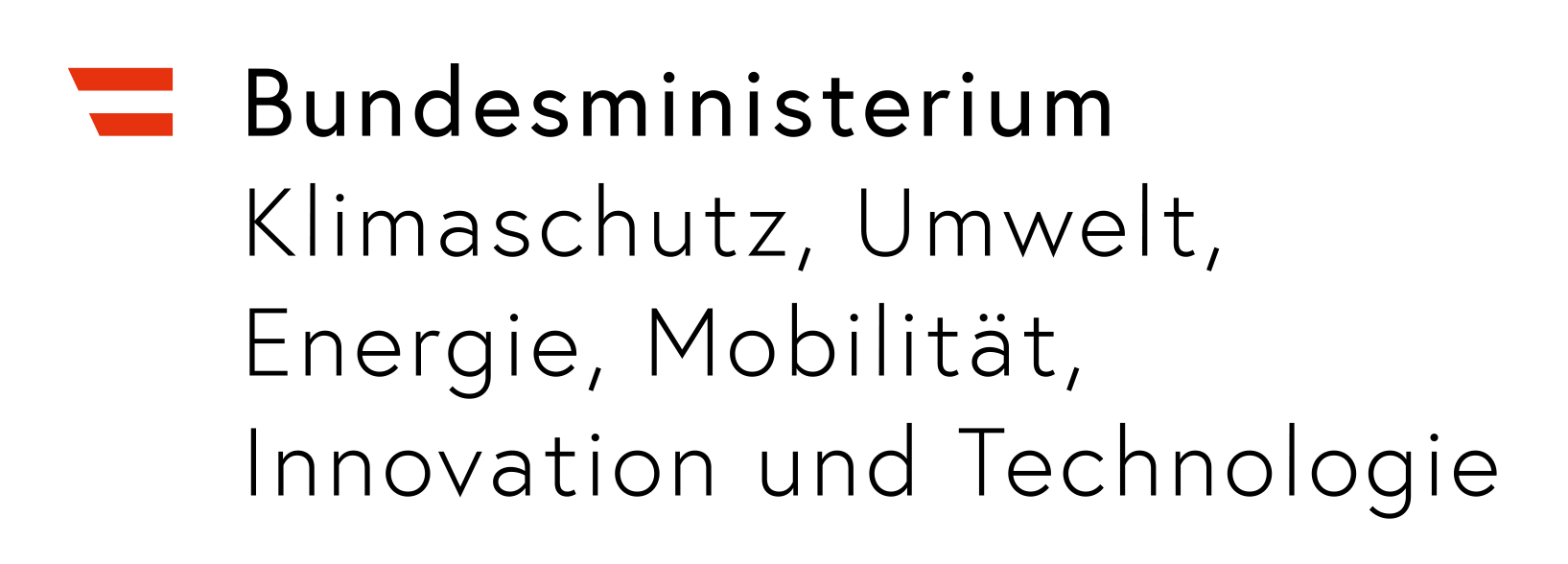28. Dezember 2015
Neues Supercomputing-Zentrum: Petabyte mit Pflanzenbildern sammeln
Wien – Am Vienna Biocenter in Wien-Landstraße wird auch die Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana), der Modellorganismus der Pflanzengenetiker, in den Magnetresonanztomografen für Kleintiere gelegt. Das klingt für Laien vielleicht nach Notlösung, man nennt es aber gemeinschaftliche Infrastrukturnutzung. Am Biocenter ist das Unternehmen Campus Science Support Facilities (CSF) dafür zuständig. Bis hin zur vielzitierten Gen-Schere CRISPR/Cas9 können sie Technologien ausleihen.
Die Kunden sind nicht nur die Nachbarn am Biocenter, also das Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA), das Gregor-Mendel-Institut (GMI), die Max F. Perutz Laboratories (MFPL) und das Institut für Molekulare Pathologie (IMP). Seit kurzem greifen auch Forschungsstätten wie die Med-Uni Wien, die Vetmed-Uni Wien, das IST Austria in Klosterneuburg und das Austrian Institute of Technology (AIT) auf die Infrastruktur der CSF zu.
Gemeinsam Infrastruktur nutzen und ihren Betrieb dadurch leistbar machen: Einen ganz ähnlichen Gedanken verfolgt Markus Kiess, seit 2009 kaufmännischer Geschäftsführer des GMI, wenn es um die Frage der Datenspeicherung geht. Aufgrund der „fortschreitenden Technologisierung“ der Pflanzenforschung sammeln Wissenschafter in immer mehr Projekten große Datenmengen an, bestätigt der gebürtige Schweizer. Und ergänzt scherzhaft: „Datenmengen, die man längst nicht mehr am PC unter dem Schreibtisch des Forschers speichern kann.“ Kiess präzisiert: Wir reden hier von dutzenden Terabytes oder mehr pro Projekt, insgesamt annähernd 1,5 Petabyte für das Institut.“ Das klingt nicht nur nach viel. Die Datenmenge lässt sich recht eindrucksvoll in Byte umwandeln. Dabei gilt: 1,5 Petabyte sind 1500 Terabyte, also 1.500.000.000.000.000 Byte.
Neues Supercomputing-Zentrum
Man muss sich das so vorstellen: Hochauflösliche Bilder entstehen in Millisekunden in großer Menge – können aber alle entscheidende Hinweise für das jeweilige Projekt liefern. „Hier ist die Bioinformatik gefragt“, erklärt Kiess, der selbst Biochemie studiert hat und vor seinem Engagement beim GMI, einem Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), beim Pharmakonzern Novartis beschäftigt war. Für Kiess ist eines klar: Die Speicherung dieser Datenmengen kann ein österreichisches Forschungsinstitut in Zukunft allein nicht mehr bewältigen. Dazu brauchte es ein Daten- und Rechencenter, das nicht nur dem GMI, sondern auch anderen Life-Science-Forschungszentren zur Verfügung stehen würde. Kiess sieht dafür ein großes Vorbild in Österreich: Der Vienna Scientific Cluster Supercomputer VCS von der TU im Wiener Arsenal. Ein neues Supercomputing-Zentrum für Biologen und Bioinformatiker könnte dort gebaut werden.
Das Gregor-Mendel-Institut gehört mit einem Jahresbudget von zwölf Millionen Euro zu den besser dotierten Forschungszentren des Landes. 15 Prozent davon gehen in die Anschaffung von Geräten für die Wissenschaft, zehn weitere Prozent kosten der Betrieb und die Instandhaltung der Labors.
Kiess begrüßt die Initiative, die Forschungsinfrastruktur des Landes nun erstmals seit sieben Jahren wieder mit einem Call zu fördern: Dafür stehen 16 Millionen Euro extra von der Österreichischen Nationalstiftung zur Verfügung. Das sei einmal ein guter Neuanfang, um die Unterstützung der Infrastruktur für Grundlagenforschungen wieder mehr in der Vordergrund zu rücken. Mehr „Incentives“ müssten folgen.
Kiess sieht das Institut international auf einem guten Weg. „Wir spielen im Wettbewerb um die besten Köpfe in einer Liga der wichtigsten Pflanzenforschungsinstitute, etwa Stanford University oder die Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland, mit.“ Da sei oft Flexibilität gefragt: Und das stimmt Kiess positiv. Man könne nämlich deutlich schneller handeln als vergleichbare Universitätsinstitute, sagt er.
Die besten Köpfe würden sich aber nicht nur für das GMI entscheiden, sondern auch für den am Biocenter gepflegten Austausch mit Genetikern, die im Tiermodell an ähnlichen Fragestellungen arbeiten.
Wichtig sei auch das hierzulande „stabile politische Umfeld“. Das spreche für Wien – wodurch die Bundeshauptstadt als Standort Vorteile gegenüber Forschungsstätten in Ländern wie China habe, wo deutlich mehr investiert werde. (pi, 28.12.2015)